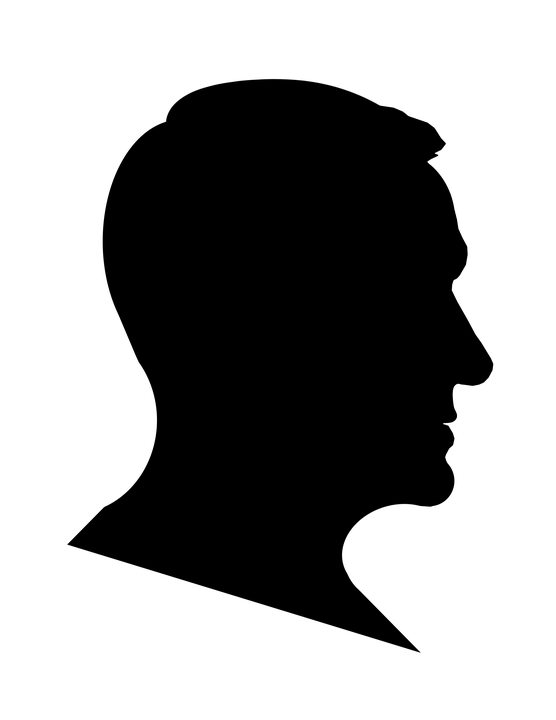|
|
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| border="1" cellspacing="5" cellpadding="2" style="border-color:#640064; border-width:2px;border-style:dashed;background-color:#ffffff;text-align:left;width:inherit;empty-cells:hide;border-collapse:default;" | | {| class="prettytable" width="100%" |
| |-style="background-color:#c7c7c7;color:#640064;font-size:120%" class="Verlauf"
| | |- bgcolor="#B40404" |
| ! width="10%" colspan="2"| Grund-Information
| | !<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> |
| |-style="text-align:center;" | | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> |
| | | |- |
| |colspan="2"|[[datei:Haus-Plankengasse 7-01.jpg{{!}}150px]]
| | | style="background-color:#dedede" | [[datei:Haus-Plankengasse 7-01.jpg|200px|center]] |
| Dorotheergasse 15
| | | style="background-color:#dedede" | |
| | {| class="prettytable" width="100%" |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen |
| Zeile 11: |
Zeile 12: |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer |
| |style="background-color:#ffffff;" | 1111 | | |style="background-color:#ffffff;" | vor 1862: Teil von 1111 | vor 1821: 1177 | vor 1795: 1142 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr |
| Zeile 18: |
Zeile 19: |
| |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt |
| |style="background-color:#ffffff;" | Johann Amann | | |style="background-color:#ffffff;" | Johann Amann |
| | |} |
| |} | | |} |
|
| |
|
|
| |
|
| == Klosterneuburger Hof - Architektur und Geschichte == | | == Das Haus - Architektur und Geschichte == |
| | | [[File:1 - Plankengasse 1111.jpg|thumb|Haus Stadt 1111]] |
| Informationen folgen in Kürze
| | 1803 wurde dieses Haus von Johann Amann erbaut. Auch über diese Parzelle erstreckte sich ehemals der Klosterneuburger Hof. |
| | |
| Krauß Karl (1834 Ritter von 1852 Freiherr von), * 13. September 1789 Lemberg, Galizien (Lwow, Ukraine), † 5. März 1881 Wien 1, Plankengasse 7, Jurist. Trat 1809 in den Staatsdienst ein, wurde 1825 Direktor der juridischen Fakultät an der Universität Lemberg, 1833 Präsident des galizischen Landrechts und 1846 Vizepräsident der Obersten Justizstelle. 1850 wurde Krauß in den Wiener Gemeinderat gewählt, 1851 war er Justizminister und 1857 wurde er zum Ersten Präsidenten des Obersten Gerichtshofs beziehungsweise 1867 zum Präsidenten des Reichsgerichts ernannt. Mitglied des Herrenhauses ab 1861. Ehrenbürger der Stadt Wien (8. April 1859).
| |
| | |
| Sein jüngerer, aber 20 Jahre früher verstorbener Bruder Philipp von Krauß (1792–1861) war 1848–1851 k.k. Finanzminister, sein Bruder Franz Beamter. Sie stammten aus einer bayrisch-österreichischen Beamtenfamilie;[1] ihr Vater hatte einen Posten im Kronland Galizien. Franz' Sohn Franz von Krauß wurde 1885 in Wien Polizeipräsident.
| |
| | |
| Leben[Bearbeiten]
| |
| | |
| Karl von Krauß studierte in Lemberg Jus und trat 1809 in den Staatsdienst. 1825 wurde er Direktor der juridischen Fakultät der Universität Lemberg, 1833 Präsident des galizischen Landrechts und 1846 Vizepräsident der Obersten Justizstelle, des Vorgängers des 1848 gegründeten Obersten Gerichtshofes von Österreich.
| |
| | |
| 1850 wurde Krauß in den Wiener Gemeinderat gewählt.
| |
| | |
| 1851 ernannte Kaiser Franz Joseph I., damals 21 Jahre alt, den 62-Jährigen zum Justizminister. Der Monarch regierte zu dieser Zeit, die später Neoabsolutismus genannt wurde, ohne Parlament. Sein Regierungschef war bis 1852 der um dreißig Jahre ältere Fürst Schwarzenberg, dann Graf Buol, um 33 Jahre älter als der Kaiser.
| |
| | |
| Nach seiner Ministerschaft wurde Krauß 1857 vom Kaiser zum Präsidenten des Obersten Gerichtshofes ernannt. 1859 verlieh ihm die Stadt Wien die Ehrenbürgerwürde. Ab 1861 war er außerdem, vom Kaiser auf Lebenszeit berufen, Mitglied des neu konstituierten Herrenhauses des Reichsrats.
| |
| | |
| 1867, nun schon 78 Jahre alt, wurde er vom Kaiser zum Präsidenten des Reichsgerichts, des neuen Gerichtshofs des öffentlichen Rechts für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder (Cisleithanien), designiert. Das Reichsgericht nahm seinen Betrieb 1869 auf.
| |
| | |
| Krauß starb im Stadtzentrum Wiens im Haus Plankengasse 7. Sein Leichnam wurde am 7. März 1881 unter Beteiligung der obersten Beamten des kaiserlichen Hofstaates, dreier Erzherzoge und vieler anderer prominenter Persönlichkeiten in der Hofpfarrkirche St. Augustin eingesegnet und auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet.[2]
| |
| | |
| Er hinterließ zwei Söhne: Sektionschef Karl Freiherr von Kraus und Landesgerichtsrat Heinrich Freiherr von Kraus.
| |
| | |
| | |
| Klosterneuburger Hof. Wie andere Klöster besaß auch das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg Höfe in Wien, die als Quartier für Konventmitglieder sowie zur Verwaltung der Besitzungen, zur Lagerung landwirtschaftlicher Produkte (Wein) und zur teilweisen Vermietung dienten.
| |
| 1, Dorotheergasse 11 (Plankengasse 7, Spiegelgasse 12) und Dorotheergasse 13 (Plankengasse 6, Spiegelgasse 14): Der auf dem gesamten Areal befindliche, vormalige dem Chorherrenstift St. Dorothea gehörende Hof (Dorotheerhof) wurde nach Aufhebung dieses Klosters (1796) verstaatlicht und 1800 vom Stift Klosterneuburg erworben, das ihn abbrechen ließ. An seiner Stelle entstanden 1803-1807 zwei Miethäuser, zwischen denen eine Gasse angelegt wurde (Neuburger Gasse, 1862 in die Plankengasse einbezogen). | |
| | |
| Dorotheerhof (1, Dorotheergasse 13 und 15, Spiegelgasse 12-14, Plankengasse 6 und 7; (Konskriptionsnummer 1111), ein weitläufiges Gebäude, das im Lauf des 15. Jahrhunderts vom Dorotheerkloster erworben wurde und das Areal der heutigen Plankengasse mit einschloss. Bis ins 18. Jahrhundert blieb es einstöckig.
| |
| | |
| Der Dorotheerhof gehörte bis zu dessen Aufhebung (1782) dem Dorotheerkloster, dann fiel er an das Stift Klosterneuburg (Klosterneuburger Hof), das ihn 1802 abbrechen ließ. 1804-1806 wurden an seiner Stelle zwei Miethäuser errichtet, zwischen denen die Neuburger Gasse (seit 1864 Plankengasse) angelegt wurde.
| |
| | |
| Hier hatte Matthias Steinl seine Heimstätte, wo er am 18. April 1727 auch verstarb.
| |
| | |
| Gewerbe und Firmen innerhalb des Hauses im Lauf der Jahre
| |
| Alte Leopoldsapotheke (seit 1804)
| |
| | |
| | |
| Der Kunsthandel Kolhammer ziert nun schon seit geraumer Zeit das Antiquitätenviertel in der Wiener Innenstadt. Mit viel Liebe und Leidenschaft betreiben die beiden Jungunternehmer eine exquisite Galerie mit einem vielschichtigen Angebot. Der Fokus liegt auf Objekten der Wiener Werkstätte, Glas der Firma Loetz und Skulpturen der Werkstätte Hagenauer. Das Inventar wird zusätzlich mit hochqualitativen Jugendstilexponaten aus Europa und Amerika ergänzt. Als eine der wenigen Kunsthändler im ersten Bezirk bietet die Firma Kolhammer auch Möbel von hoher Qualität aus der Zeit des Wiener Jugendstils an. Objekte nach Entwürfen von Josef Hoffmann, Koloman Moser, Otto Wagner und Joseph Urban können bewundert und probeweise auch benutzt werden.
| |
| | |
| Florian und Nikolaus Kolhammer sind familiär schon seit ihrer Geburt sehr eng mit der Kunst verbunden gewesen. Beide Elternteile gehörten während ihrer beruflichen Tätigkeit zu den besten Kunsthändlern Österreichs und gelten auch heute noch als Experten auf ihren Gebieten. Auch der Großvater väterlicherseits begann in der Zeit um 1920 seine Tätigkeit als Altwarenhändler. Diese offensichtliche Liebe zur Kunst wurde Nikolaus und Florian von Kindesbeinen an näher gebracht und so waren auch regelmäßig Besuche von Kunstmessen und Museen Teil ihrer Jugend. Nach der Matura und anschließendem Präsenzdienst stiegen die beiden Brüder in den Kunsthandel des Vaters ein. Dort wurde ihnen das erste Mal der enorme Umfang des Kunsthandels bewusst und sie begannen ihre ersten Schritte in der Welt der bildenden Kunst.
| |
| | |
| Nach einigen Jahren war der Wunsch gewachsen eine eigene Galerie zu eröffnen. Eine Spezialisierung war auch bereits gefunden denn Florian und Nikolaus hatten ihr Herz komplett an den Jugendstil und das einhergehende Design verloren. Besonders begeisterte die beiden Brüder die Genialität der Entwürfe von berühmten Künstlern wie Josef Hoffmann, Koloman Moser, Dagobert Peche, Louis Comfort Tiffany, die Brüder Hagenauer, Charles Rennie Macintosh und Archibald Knox. Mithilfe ihres Vaters und ihrer Mutter entstand also in der Plankengasse 7 eine Kunstgalerie mit besonderem Augenmerk auf Kunstgewerbe. Anfangs noch mit großer Hilfe durch die beiden Eltern machten sich Nikolaus und Florian zuerst in Österreich und kurz danach auch international einen Namen der auch heute noch für Qualität, Kundenservice und perfekter Betreuung steht.
| |
| | |
| Im Jahr 2010 wurde die Galerie in der Plankengasse mit moderner LED Beleuchtung ausgestattet und durch eine Renovierung nochmals den Bedürfnissen eines hochqualitativen Kunsthandels angepasst.
| |
| | |
| Neben diesen Änderungen veröffentlichten Florian und Nikolaus auch sechs Kataloge mit hochqualitativen Exponaten die weltweit am Kunstmarkt Beachtung fanden. Zusammenarbeiten mit verschiedenen Museen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Paris, Berlin und natürlich in Wien, unterstreichen diesen internationalen Anspruch noch zusätzlich. Neben Messen in Österreich wird der Kunsthandel Kolhammer ab 2016 auch internationale Auftritte wie zum Beispiel in München, Brüssel, Miami und London präsent sein.
| |
| https://www.kunsthammer.at/
| |
| | |
| | |
| http://www.ephelant-verlag.at/
| |
|
| |
|
| Handel mit NS-Relikten: Ein Judenstern mitten im Ersten
| | === Der Klosterneuburger Hof, vormals Dorotheerhof === |
| | |
| 25.04.2009 | 17:32 | von RAINER NOWAK (Die Presse)
| |
| | |
| Im ersten Wiener Gemeindebezirk werden in einem Antiquitätengeschäft - ums Eck vom Jüdischen Museum - originale Judensterne verkauft. Auch sonst blüht der Handel mit NS-Relikten. Trotz oder wegen des Verbotsgesetzes.
| |
|
| |
|
| | Der erste Hof, der sich hier befunden hatte war der des Chorherrenstiftes St. Dorothea. Er wurde nach Aufhebung des Dorotheerklosters 1796 verstaatlicht und vier Jahre später dem Stift Klosterneuburg verkauft. |
| | | |
|
| | Der damals einstöckige Hof diente zur Verwaltung der Besitzungen und zur Lagerung der landwirtschaftlichen Produkte, vor allem von Wein. 1804 wurde der Hof abgerissen, an seiner Stelle wurden zwei Mietshäuser errichtet. |
|
| |
|
|
| | == Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten == |
|
| |
|
| | === Wohn- und Sterbehaus des Juristen Karl Krauß === |
|
| |
|
| | {| class="prettytable" width="100%" |
| | |- bgcolor=" #37526f" |
| | !<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> |
| | !<span style="color:#ffffff"> ''' xxx '''</span> |
| | |- |
| | | style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] |
| | | style="background-color:#dedede" | |
| | Karl Krauß (* 13. September 1789 Galizien, † 5. März 1881, ebenhier) war ab 1851 Justizminister und ab 1857 Erster Präsident des Obersten Gerichtshofs. Sein Neffe, Franz Krauß, war ab 1885 Wiener Polizeipräsident. |
| | |} |
|
| |
|
|
| | === Wohn- und Sterbehaus des Bildhauers Matthias Steinl === |
|
| |
|
| |
|
| | {| class="prettytable" width="100%" |
| | |- bgcolor=" #37526f" |
| | !<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> |
| | !<span style="color:#ffffff"> ''' Matthias Steinl'''</span> |
| | |- |
| | | style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] |
| | | style="background-color:#dedede" | |
| | Der gelernte Kunsttischler [[Matthias Steinl]] (* um 1643/1644 Land Salzburg, † 18. April 1727, ebenhier) kam aus Leubus über Breslau und Nürnberg nach Wien. Leopold I. nahm in 1688 als "Kammerbeinstecher" auf, Steinls wahre Berufung war jedoch die Bildhauerei. Zu seinen Werken gehören großartige Kunstwerke, die heute noch im 1. Bezirk zu finden sind: |
|
| |
|
| | * Eine elfenbeingefertigte Kreuzigungsgruppe (Schatzkammer) |
| | * Eine Allegorie des Wassers und der Luft, ebenfalls aus Elfenbein (Kunsthistorisches Museum) |
| | * Reiterstatuetten von Leopold I. und Karl VI. (Kunsthistorisches Museum) |
| | * Die Kanzel der [[Dominikanerkirche]], hier ist ein Selbstbildnis am Stiegenaufgang eingearbeitet |
| | * Der Sebastiansaltar in der [[Franziskanerkirche]] |
| | * Der ehemalige Hochaltar der alten Burgkapelle |
| | * Der Josephs-Altar im [[Stephansdom]] |
| | * Großplastiken am heutigen Seitenaltar der [[Kapuzinergruft]] |
| | * Eine Figurengruppe, die Kanzel und das Gehäuse der Orgel der [[Peterskirche]] |
|
| |
|
|
| | In diesem Haus wohnte Steinl von 1703 bis zu seinem Tod. Er wurde im Stephansdom begraben. |
| | |} |
|
| |
|
| Drucken
| | == Shopping == |
|
| |
|
| Versenden
| | === Kunsthandel und Galerie Kohlhammer === |
|
| |
|
| |
| Vorlesen
| |
|
| |
| AAA
| |
| Schriftgröße
| |
| | |
| Kommentieren
| |
|
| |
|
| |
|
| Ist der echt?“ „Natürlich.“ „Und der kleine da?“ „Das ist ein Kinderjudenstern.“ „Den mussten die kleinen Kinder tragen?“ „Sage ich ja, ein Kinderjudenstern.“ „Und was kostet der?“ „Dreizwanzig!“ „Drei Euro zwanzig.“ „Nein, natürlich 320 Euro.“
| | Im Kunsthandel der Brüder Kohlhammer erhält man vor allem Objekte der Wiener Werkstätte, Glas der Firma Loetz und Skulpturen der Werkstätte Hagenauer. aber auch Jugendstilmöbel kann man hier erwerben.<ref>https://www.kunsthammer.at/</ref> |
|
| |
|
|
| | === Ephelant-Verlag === |
|
| |
|
| Alte Kunst und Militaria
| | In dem Haus ist auch der Sitz des kleinen Verlages Ephelant.<ref>http://www.ephelant-verlag.at/</ref> |
|
| |
|
| Thomas Köck, Plankengasse 7, A-1010 Wien
| | === Handel mit NS-Relikten, Alte Kunst und Militaria === |
| +43-(0)1-5193987, E-Mail: thomas@militaria-koeck.at
| |
| Internet: http://www.militaria-koeck.at/
| |
| Militaria, Antiquitäten, Orden, Blankwaffen und jede Art von Antiquitäten | |
|
| |
|
| http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/473884/Handel-mit-NSRelikten_Ein-Judenstern-mitten-im-Ersten | | Unglaublich, aber tatsächlich so: In diesem Haus werden NS-Relikte verkauft. In unmittelbarere Nachbarschaft des Jüdischen Museums wird - trotz Verbotsgesetz - mit Gasmasken, Judensternen und sonstigen Memorabilien dieser Zeit gehandelt.<ref>25.04.2009, Die Presse:http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/473884/Handel-mit-NSRelikten_Ein-Judenstern-mitten-im-Ersten</ref> |
|
| |
| Der winzige Judenstern wird von dem Händler in der Wiener Plankengasse mit einer Pinzette wieder vorsichtig an die Glasscheibe in der Auslage mittels Klebestreifen befestigt. In dem Sammelsurium sieht man ihn von draußen kaum, unzählige Vasen, Figuren und Kistchen stehen in der Auslage, in der ebenso wenig ein Millimeter frei ist wie drinnen, in dem winzigen Geschäft, in dem neben den beiden Eigentümern kaum mehr Platz für den potenziellen Kunden ist. „Ist es nicht verboten, das zu verkaufen?“, so die naive Frage. „Nein, überhaupt nicht, lautet die Antwort in beruhigendem Tonfall. Ist schließlich kein NS-Propagandamaterial. Über das Heft mit dem klingenden Titel „Als die Sudetendeutschen befreit wurden“ könnte man vielleicht diskutieren, aber ein Judenstern ist offenbar nur ein historisches Relikt. Ähnlich wie die anderen Erinnerungsstücke, die Gasmaske aus einem der beiden Weltkriege oder eine Kaffeetasse mit dem väterlichen Antlitz Kaiser Franz Josephs: Um die Ecke vom Jüdischen Museum Wien kann man sich eben mit Memorabilien eindecken. Ganz legal, ganz normal.
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Das „schriftstellerische“ Hauptwerk Adolf Hitlers hingegen ist verboten, es zu verkaufen oder zu erwerben fällt unter Wiederbetätigung und wird somit nach dem Verbotsgesetz geahndet. Will man als historisch interessierter Leser die kruden Pläne und die wirre Welt des sogenannten Führers nachlesen, begibt man sich in die Illegalität. Das ist in Wien nicht allzu schwer, neben Trödelläden – jener in der Plankengasse ist damit ausdrücklich nicht gemeint – ist der Flohmarkt auf dem Wiener Naschmarkt der ideale Ort dafür. Wobei man da auch das eine oder andere Hakenkreuz oder SS-Abzeichen findet, wenn man die richtigen Händler kennt und unschuldig genug Geld auf den dort üblichen Tapezierertisch legt.
| | ---- |
| | |
| Dass der Handel mit NS- und vor allem Adolf-Hitler-Devotionalien nach wie vor gut geht, ließ sich am vergangenen Donnerstag beobachten. Gemalte Bilder von Adolf Hitler erzielten bei einer Auktion in England Höchstpreise. Dreizehn Bilder aus der Zeit von 1908 bis 1914 wurden für mehr als 95.000 Pfund (106.500 Euro) versteigert. In dieser Zeit lebte Hitler (bis 1913) großteils in Wien, zwei Mal wurde er von der Akademie der bildenden Künste abgelehnt. Eigentlich waren nur um die 6000 Pfund erwartet worden, hieß es im Auktionshaus Mullock's in der westenglischen Grafschaft Shropshire, doch das Interesse an Bildern mit der Signatur A. H. ist eben enorm. Die Arbeiten waren nach Angaben des Auktionators übrigens vor einigen Monaten in einer Garage gefunden worden.
| |
| | |
| | |
| Einen ausgeprägten österreichischen „Kunstmarkt“ für Hitler-Bilder gibt es aber nicht, hier sind es eher Uniformen und Abzeichen, die Käufer oder zumindest Schaulustige anlocken: Vor wenigen Jahren wurde in Klagenfurt ein kleines „privates“ Museum ausgehoben. Dort gab es verschiedene Schauräume wie einen SS-Raum, einen Russen-Raum und einen KZ-Raum. Überregional bekannt wurde die Existenz des Nazimuseums (Eigendefinition des damals, 2004, 84-jährigen „Betreibers“ und Landwirts) übrigens erst, weil Stücke im Wert von 36.000 Euro (laut Schätzung des Sachverständigen) gestohlen worden waren – von einem Bekannten. Der rechtfertigte sich vor Gericht damit, dass er die Schätze nur in Sicherheit bringen wollte, weil doch ein Besuch der Staatspolizei gedroht habe.
| |
| | |
| Die Gefahr, dass Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz, wie die Staatspolizei heute heißt, in Österreichs Antiquitätenläden auf die Suche nach braunen Devotionalien gehen, ist überschaubar: Vor einigen Jahren konnte man an Wiens unter Sammlern bekannten Adressen problemlos SS-Uniformen und „Mein Kampf“ kaufen. Erstgenannte sind heute kaum mehr auf dem Markt, meint ein Händler. Und „Mein Kampf“ geht bequem von zu Hause aus, die Erstauflage bei eBay gibt es um 269,9 Euro. Judensterne noch nicht.
| |
|
| |
|
| ----
| | Gehe weiter zu [[Dorotheergasse 16]] | [[Spiegelgasse 15]] |
| Gehe weiter zu [[Dorotheergasse] 16] | |
|
| |
|
| Gehe zurück zu [[Dorotheergasse]] | [[Plankengasse]] | [[Spiegelgasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | | Gehe zurück zu [[Dorotheergasse]] | [[Plankengasse]] | [[Spiegelgasse]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] |
| Zeile 138: |
Zeile 94: |
| [[Kategorie:Gebäude]] | | [[Kategorie:Gebäude]] |
| [[Kategorie:Architekten:Johann Amann]] | | [[Kategorie:Architekten:Johann Amann]] |
| | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] |
| | [[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] |
| | [[Kategorie:Shopping]] |
| | |
| | == Quellen == |