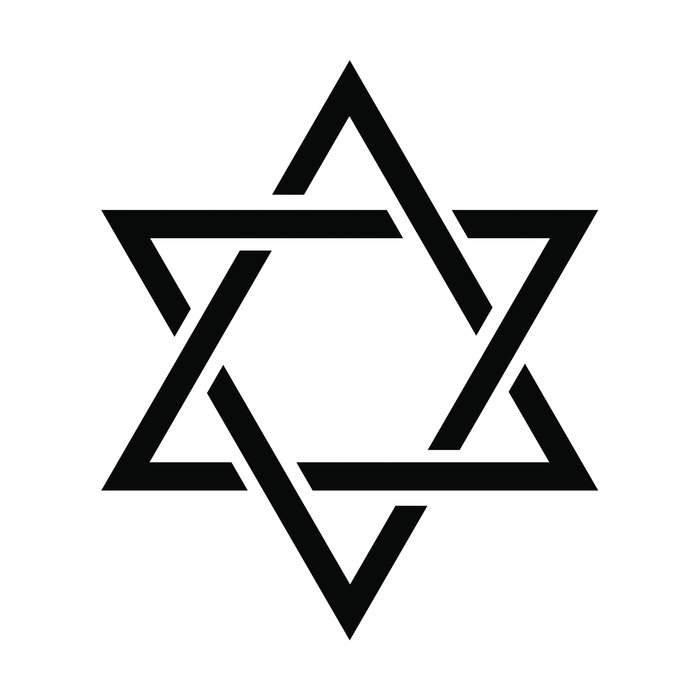Judenplatz
| Judenplatz | |
|---|---|
| Bezirk | 1., Innere Stadt |
| Benennung | 1437 (Erstnennung: 1294) |
| Benannt nach | ansässigen Juden, Judenstadt |
| Straßenlänge | 83,32 Meter [1] |
| Gehzeit | 1 Minute |
| Vorherige Bezeichnungen | Schulhof |
Namensgebung und Geschichte
Bis 1421 war hier die jüdische Stadt – mit der ersten Synagoge (die Or-Sarua-Synagoge), dem Haus des Rabbis und einem Spital. Insgesamt waren etwa 70 Häuser mit rund 800 Bewohnern hier angesiedelt.
Juden am Judenplatz - erduldet und vertrieben
Juden waren im alten Wien nicht unwillkommen – zumal sie an die herrschenden Schichten verzinste Darlehen gaben, während es Christen untersagt war, Zinsen zu verlangen (Juden durften das). Juden vorfinanzierten Feldzüge – wenn diese verloren wurden, standen die Herrscher vor unbezahlbaren Schulden. Das war auch 1420/1421 der Grund, dass Herzog Albrecht V (später Kaiser Albrecht der II) 1420 alle Juden in Österreich gefangen nehmen ließ und ihr Vermögen konfiszierte, das er dann unter den Herzögen verteilte.
Kinder unter 15 wurden zwangsgetauft, ärmere Erwachsene wurden in ein Boot gesetzt und die Donau hinuntergetrieben. Die Reichen blieben im Gefängnis (wo bereits zahlreiche starben bzw. sich umbrachten), am 12.3.1421 verurteilte der Herzog alle zum Tode. Vorgeschobener Grund war, dass ihnen ein Hostienfrevel in Enns zugeschrieben wurde, dass sie Brunnen vergiftet hätten, die Pest nach Wien gebracht hätten und dass sie christliche Kinder ermordet hätten.
Noch am selben Tag wurden 200 Juden auf der Weißgerberlände verbrannt. Erst unter Friedrich dem III. (1463) durften Juden zurück nach Wien. Die Steine der Synagoge wurden zur Erbauung der alten Wiener Universität genutzt.
Am Haus Judenplatz 2, dem Haus „Zum großen Jordan“, ist heute noch eine gotische Inschrift angeracht, die an das grausame Schicksal der Menschen hier erinnert. Sie stammt von 1500 und sollte die Ereignisse rechtfertigen. Erst 1988 wurde auf Haus 6 eine Gedenktafel angebracht, die die damaligen Ereignisse verurteilt.
Kunst im öffentlichen Raum, Denkmäler
Shoa-Mahnmal, das Holocaust-Denkmal
Im Jahr 2000 wurde auf Initiative von Simon Wiesenthal das Denkmal aufgestellt, das nun den Judenpatz dominiert. Es erinnert konkret an die Grausamkeit der Jahrhunderte, die der jüdischen Bevölkerung zugefügt worden war. Das Betonmonument wurde von Rachel Whiteread zur Erinnerung an die 65.000 österreischischen jüdischen Opfer geschaffen, die Enthüllung fand am 25.10.2000 statt.
Dazu passend gibt es ein Gedicht von Stephan Eibel Erzberg, einem zeitgenössischen Dichter:
2004 am judenplatz
nach dem kindergarten
lese ich hannah (5) vor:
auschwitz-birkenau, bergen-belsen
buchenwald, dachau, majdaanek-lublin
mauthausen, plazcov, ravensbrück
...und noch viele...viele... hannah fragt:
papa, wo waren damals die normalen leute?
(Gedicht von Stephan Eibel Erzberg)
Das Lessingdenkmal
Anfang des 20. Jahrhunderts sollte bereits das Denkmal für den Dichter Gotthold Ephraim Lessing (* 22. Jänner 1729 Kamenz, Sachsen, † 15. Februar 1781 Braunschweig) geschaffen werden, es kam aber erst in den 30er-Jahren dazu.
Häuser des Platzes
- Judenplatz 1, Zur Flucht nach Ägypten
- Judenplatz 2, Haus zum großen Jordan
- Judenplatz 3-4, Genossenschaftshaus der Gastwirte
- Judenplatz 5
- Judenplatz 6, Pazelt-Hof, Zur goldenen Säule
- Judenplatz 7, Zur kleinen Dreifaltigkeit
- Judenplatz 8, Misrachihaus, Jewish Welcome-Service
- Judenplatz 9
- Judenplatz 10
- Judenplatz 11, Böhmische Hofkanzlei
Gehe weiter zu den kreuzenden Straßen Jordangasse | Kurrentgasse | Parisergasse | Drahtgasse | Fütterergasse
Gehe zurück zu Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ Datenquelle: Stadt Wien - data.wien.gv.at