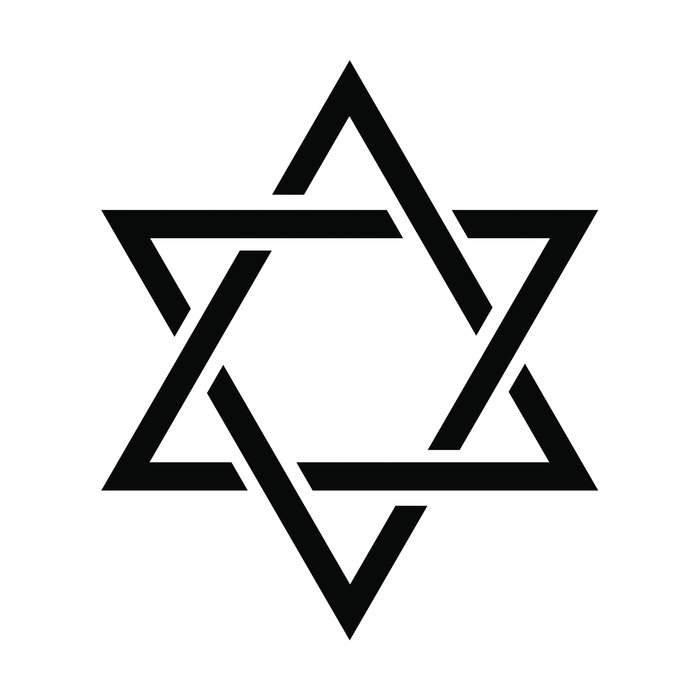Jordangasse 1-3
| Haus: Jordangasse 1-3 | Grund-Informationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das heutige Gebäude, dass 1884 fertiggestellt wurde, wurde im Krieg schwer beschädigt: Eine Bombe hatte ein breites Stück der beiden oberen Stockwerke weggerissen.
Gedenktafeln
Gedenktafel für den Komponisten Donizetti
| Wohnhaus des Komponisten Gaetano Donizetti | |
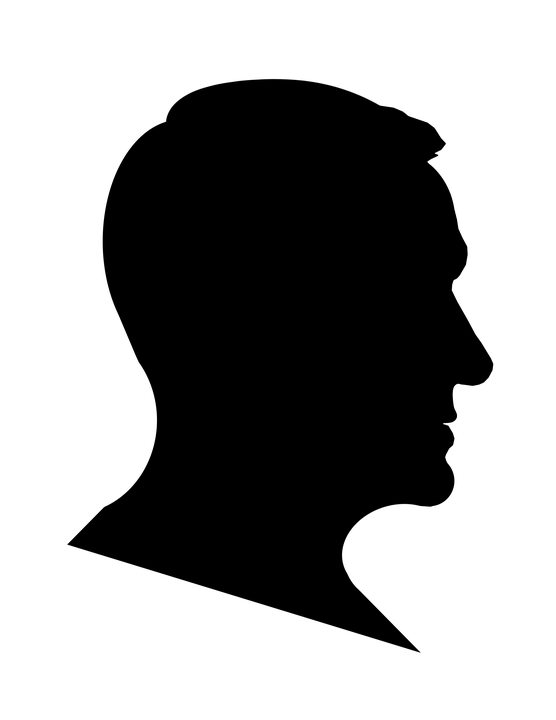 |
Während seiner Wienaufenthalte wohnte in dem Haus der Komponist Gaetano Donizetti (* 29.11.1797 in Borgo Canale, heute Bergamo, † 8.4.1848 in Bergamo). Donizetti komponierte 71 Opern, darunter "Der Liebestrank", "Don Pasquale" oder "Lucia di Lammermoor". Der Italiener hielt sich hauptsächlich in Paris und Neapel auf, wurde aber wegen seines großen Erfolges 1842 nach Wien geholt, um hier die Oper "Linda di Chamounix" zu komponieren. Kaiser Ferdinand I. ernannte ihn zu dieser Zeit zum österreichischen Hofkapellmeister. Donizetti wirkte hier auch als Gesangslehrer für die junge Marie von Marra.
Zu dieser Zeit war Donizetti schon sehr von seiner Krankheit gezeichnet - er litt an Neurolues (Synonym für Neurosyphilis). Mit der - mittlerweile übergangenen - Syphilis hatte er sich schon vor seiner Hochzeit angesteckt (seine Frau, Virginia Vasselli, gebar deshalb missgebildete Kinder und starb selbst - mit nur 29 Jahren - an der Cholera), im Alter verursachte seine Krankheit Halluzinationen und Wahnideen. Schließlich wurde er ins Irrenhaus von Ivry-sur-Seine bei Paris eingeliefert. Sein Neffe holte ihn nach Bergamo zurück, wo er 1848 starb. Donizetti wurde in einem Vorort Bergamos, im Familiengrab des Adelsgeschlechtes Pezzoli, bestattet. Als man ihn für eine Verlegung im Jahr 1875 ausgrub, stellt man fest, dass der Schädel fehlte. Die Suche danach ergab rasch, dass ein mittlerweile verstorbener Arzt des Irrenhauses den Schädel gestohlen hatte. Lange Zeit war der Schädel im "Museo donizettiano" ausgestellt, erst im Mai 1951 legte man ihn zum Rest des Skelettes. |
Vorgängerhäuser
Bevor dieses Haus errichtet wurde, hatte das Areal eine bewegte Geschichte.
In der Zeit der Judenstadt befand sich hier ein großes Gebäude, das sich zwischen Wipplingerstraße 3, Jordangasse 1 und Jordangasse 3 erstreckte. Durch die Beschlagnahmung 1421 gelangte es in den Besitz des Bürgermeisters Hans Scharfenperger, dessen Sohn es dann erbte und es in drei Teile teilen ließ.
Haus 392 (Wipplingerstraße 5) wurde 1461 erstmals urkundlich erwähnt und 1884 abgebrochen.
Haus 394 (Jordangasse 1) wurde 1664 urkundlich erwähnt, als es der kaiserliche Diener Ferdinand von Raidegg erhielt. Er ließ das alte baufällige Haus abtragen und ein Neues erbauen, was so hohe Kosten verursachte, dass er den Kaiser um 30 jährige „Quartierfreiheit“ ersuchte. Die Genehmigung erfolgte, allerdings nur durch das Geschenk eines sehr guten Weinberges.
Quartierfreiheit
Jeder Bürger, der ein Haus in Wien besaß, war verpflichtet, einen Teil davon als Hofquartier zur Verfügung zu stellen – was bedeutete, dass das Gefolge des Herrschers sehr günstigen Wohnraum erhielt, wenn dieser in Wien weilte. Die Wiener mochten diese Regelung gar nicht, denn das Benehmen der Höflinge ließ meist zu wünschen übrig, es gingen zahlreiche Beschwerden über sie ein, aber es standen auch wirtschaftliche Gründe dahinter: Die Mieteinnahmen waren dadurch weitaus geringer. Im Einzelfall konnte der Kaiser eine „Quartierfreiheit“ genehmigen, womit die Hausbesitzer von der lästigen Pflicht befreit wurden.
Ausgrabungen
| Archäologische Grabungen Jordangasse 1-3 | |
| Ausgrabung 1879 | |
| Ausgrabungscode: | 187902 |
| zeitliche Lagerung: | römisch |
| Beschreibung: | Im Jahr 1879 wurden bei Hausabbrucharbeiten römische Mauerzüge, Ziegelbruchstücke und ein As des Trajan gefunden.[1] |
Gehe weiter zu Jordangasse 2 | Wipplingerstraße 6-8
Gehe zurück zu Jordangasse | Wipplingerstraße | Schultergasse | Straßen des 1. Bezirks