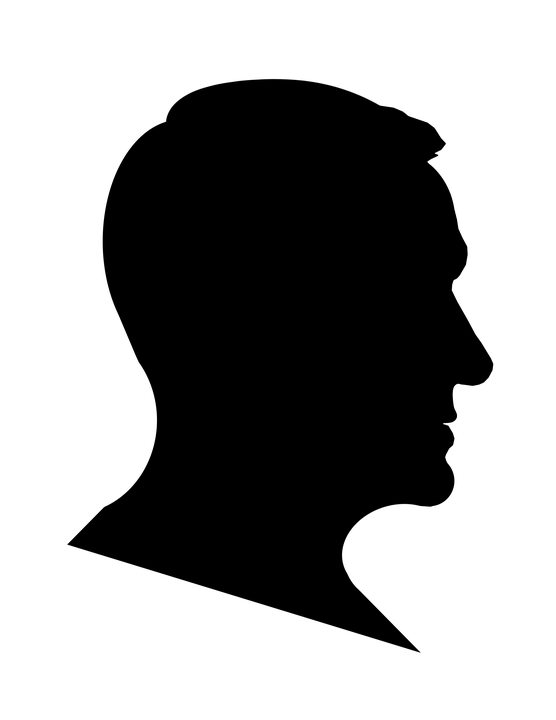Griechengasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<mockingbird.Aside no-header> | |||
<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||
<mockingbird.image wiki="Xxx.jpg" /> | |||
<mockingbird.content> | |||
;Aliasadressen | |||
: =[[Griechengasse]] 3 | |||
: =[[Franz-Josefs-Kai]] 21 | |||
: (Einst auch: Adlergasse 4) | |||
; Konskriptionsnummer | |||
: vor 1862: ''723 ''' | |||
: vor 1821: '''769 ''' | |||
: vor 1795: '''683''' | |||
; Baujahr | |||
: 1875-1878 | |||
; Wiederaufbau: | |||
: 1953 | |||
; Architekten (Bau) | |||
: [[Ferdinand Fellner d.J.]], [[Hermann Helmer]] | |||
; Wiederaufbau: | |||
: Hugo Durst | |||
</mockingbird.content> | |||
<mockingbird.map coordinates="48.2085025, 16.3806415,3a"> | |||
<mockingbird.on-map coordinates="48.2085025, 16.3806415,3a" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||
</mockingbird.aside> | |||
__TOC__ | |||
== Das Haus "Küss den Pfennig" - Architektur und Geschichte == | == Das Haus "Küss den Pfennig" - Architektur und Geschichte == | ||
| Zeile 33: | Zeile 37: | ||
Den Namen hatte das Haus von einem seiner Besitzer, dem Hans von Ofen, "den man auch Küssenpfenning nennt" (eine Anspielung auf seinen Geiz), der 1404 bis 1430 hier gewohnt hatte. 1470 scheint erstmals ein Hausschild mit dem Namen auf, damals verbaute Kaspar Zeitl zwei kleine alte Häuser zu einem neuen. | Den Namen hatte das Haus von einem seiner Besitzer, dem Hans von Ofen, "den man auch Küssenpfenning nennt" (eine Anspielung auf seinen Geiz), der 1404 bis 1430 hier gewohnt hatte. 1470 scheint erstmals ein Hausschild mit dem Namen auf, damals verbaute Kaspar Zeitl zwei kleine alte Häuser zu einem neuen. | ||
1700 war das Haus in Besitz des Wirten Gregor Farnwanger, 41 Jahre später scheint auf, dass das ehemalige Haus mit Turm einem Neubau weichen musste. Im Nebengebäude war ab 1804 die Kapelle für "griechische fremde Untertanen" zu finden, die bis dahin im Steyrerhof gewesen war. | 1700 war das Haus in Besitz des Wirten Gregor Farnwanger, 41 Jahre später scheint auf, dass das ehemalige Haus mit Turm einem Neubau weichen musste. | ||
Im Nebengebäude war ab 1804 die Kapelle für "griechische fremde Untertanen" zu finden, die bis dahin im Steyrerhof gewesen war. | |||
== Sagen und Legenden == | == Sagen und Legenden == | ||
| Zeile 43: | Zeile 49: | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor="darkred" | |- bgcolor="darkred" | ||
!<span style="color:#ffffff"> '''Die Sage vom Küss-den-Pfennig''' </span> | !<span style="color:#ffffff"> '''Die Sage vom Küss-den-Pfennig''' </span> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#dedede" | | | style="background-color:#dedede" | | ||
[[File:BERMANN(1880) p0737 Das Haus Küß-den-Pfennig.jpg|250px|thumb]] | |||
Der Wirt des „Schwarzen Adlers“ war als besonders geizig bekannt. Einmal kam spät in der Nacht ein Fremder, der um ein Zimmer bat. Der Wirt wollte ihn schon abweisen, weil er so ärmlich gekleidet war, der Fremde versprach jedoch, ihn reichlich zu belohnen, wenn er bleiben könne. Es stellte sich heraus, dass der Fremde viel länger blieb, es verstrich ein Tag nach dem anderen, und der Wirt bekam kein Geld zu sehen. Und nach dem der Wirt einige Zeit gewartet hatte, fasste er sich eines Tages ein Herz, klopfte an die Zimmertür des Fremden und forderte sein Geld ein. Der Fremde sagte, er habe im Moment kein Geld, aber er übergab ihm einen Kupferpfennig, mit dem Versprechen, ihm den Rest ein andermal zu geben. Der Wirt schleuderte zornig die Münze zu Boden und wollte die Wache holen. Da lächelte der Gast und meinte: „Ich würde den Pfennig an deiner Stelle nicht so einfach wegwerfen! Er ist viel wert…“ Der Wirt bückte sich und sah überrascht, dass der Pfennig aus Gold war, und damit viel mehr wert, als der Gast ihm schuldete. | Der Wirt des „Schwarzen Adlers“ war als besonders geizig bekannt. Einmal kam spät in der Nacht ein Fremder, der um ein Zimmer bat. Der Wirt wollte ihn schon abweisen, weil er so ärmlich gekleidet war, der Fremde versprach jedoch, ihn reichlich zu belohnen, wenn er bleiben könne. Es stellte sich heraus, dass der Fremde viel länger blieb, es verstrich ein Tag nach dem anderen, und der Wirt bekam kein Geld zu sehen. Und nach dem der Wirt einige Zeit gewartet hatte, fasste er sich eines Tages ein Herz, klopfte an die Zimmertür des Fremden und forderte sein Geld ein. Der Fremde sagte, er habe im Moment kein Geld, aber er übergab ihm einen Kupferpfennig, mit dem Versprechen, ihm den Rest ein andermal zu geben. Der Wirt schleuderte zornig die Münze zu Boden und wollte die Wache holen. Da lächelte der Gast und meinte: „Ich würde den Pfennig an deiner Stelle nicht so einfach wegwerfen! Er ist viel wert…“ Der Wirt bückte sich und sah überrascht, dass der Pfennig aus Gold war, und damit viel mehr wert, als der Gast ihm schuldete. | ||
| Zeile 72: | Zeile 77: | ||
=== Paracelsus === | === Paracelsus === | ||
Der Gelehrte, der sich [[Paracelsus]] nannte, war eigentlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ein Arzt und Alchemist. Er hatte angeblich ein Mittel gefunden, das jegliches Metall zu Gold verwandelte. Paracelsus war in seiner Zeit ein nicht viel beachteter Arzt, obwohl seine Heilungserfolge überragend waren. Er stellte die „Vier-Säfte-Lehre“ auf, die die Grundlage der modernen Ernährung war und war der Erste, der auf der Universität in Deutsch (und nicht in Latein) unterrichtete. Berühmt wurde er durch seine Erfindung des „Laudanum“ – einer Mixtur aus Opium, Nachtschattenalkoiden, Perlmutt, Froschsperma und Zimt. | [[File:KopfX.png|75px|left]] Der Gelehrte, der sich [[Paracelsus]] nannte, war eigentlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ein Arzt und Alchemist. Er hatte angeblich ein Mittel gefunden, das jegliches Metall zu Gold verwandelte. Paracelsus war in seiner Zeit ein nicht viel beachteter Arzt, obwohl seine Heilungserfolge überragend waren. Er stellte die „Vier-Säfte-Lehre“ auf, die die Grundlage der modernen Ernährung war und war der Erste, der auf der Universität in Deutsch (und nicht in Latein) unterrichtete. Berühmt wurde er durch seine Erfindung des „Laudanum“ – einer Mixtur aus Opium, Nachtschattenalkoiden, Perlmutt, Froschsperma und Zimt. | ||
Er selbst starb (trotz zahlreicher anders lautender Gerüchte: Man habe ihn vergiftet, man habe ihn einen Felsen hinabgestürzt, er sei in Folge seines Alkoholkonsums an Leberkrebs gestorben bzw. er sei im Rausch eine Treppe herunter gestürzt und so fort) an eine Quecksilbervergiftung. Heute ist der höchste Preis, der in Deutschland an verdiente Ärzte vergeben wird, die Paracelsus-Medaille, und in Salzburg (hier lebte P. lange) wird der Paracelsus-Ring der Stadt Salzburg für hervorragende wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen verliehen. | Er selbst starb (trotz zahlreicher anders lautender Gerüchte: Man habe ihn vergiftet, man habe ihn einen Felsen hinabgestürzt, er sei in Folge seines Alkoholkonsums an Leberkrebs gestorben bzw. er sei im Rausch eine Treppe herunter gestürzt und so fort) an eine Quecksilbervergiftung. Heute ist der höchste Preis, der in Deutschland an verdiente Ärzte vergeben wird, die Paracelsus-Medaille, und in Salzburg (hier lebte P. lange) wird der Paracelsus-Ring der Stadt Salzburg für hervorragende wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen verliehen. | ||
== Ausgrabungen == | == Ausgrabungen == | ||
{| class="toccolours " | |||
{| class=" | |- style="background:#fff8dc;" | ||
|- | |||
! Ausgrabungscode | ! Ausgrabungscode | ||
! zeitliche Lagerung | ! zeitliche Lagerung | ||
! Beschreibung der Fundstücke | ! Beschreibung der Fundstücke | ||
|- | |- | ||
| 187402 | | 187402 | ||
| römisch | | römisch | ||
| Zeile 103: | Zeile 105: | ||
== Stein der Erinnerung == | == Stein der Erinnerung == | ||
In der Straße | In der Straße sind Steine der Erinnerung eingelassen. | ||
[[File:Erinnerungsstein für Clara Lichtenstein-Chary und Gerda Lichtenstein.JPG|thumb|250px|center|Erinnerungsstein für Clara Lichtenstein-Chary und Gerda Lichtenstein]] | |||
[[File:Xxx.jpg|250px|thumb|center|48 jüdische Frauen und Männer]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Zeile 189: | Zeile 119: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Ferdinand Fellner II]] | [[Kategorie:Architekten:Ferdinand Fellner II]] | ||
[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:Hermann Helmer]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Hugo Durst]] | [[Kategorie:Architekten:Hugo Durst]] | ||
[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2024, 06:23 Uhr

- Aliasadressen
- =Griechengasse 3
- =Franz-Josefs-Kai 21
- (Einst auch: Adlergasse 4)
- Konskriptionsnummer
- vor 1862: 723 '
- vor 1821: 769
- vor 1795: 683
- Baujahr
- 1875-1878
- Wiederaufbau
- 1953
- Architekten (Bau)
- Ferdinand Fellner d.J., Hermann Helmer
- Wiederaufbau
- Hugo Durst
Das Haus "Küss den Pfennig" - Architektur und Geschichte
Das Haus, das 1875 erbaut wurde, war im Krieg schwer getroffen worden, den Wiederaufbau nahm Hugo Durst vor. Hier gibt es etwas Besonderes: die Ein-Mann-Stück-Bühne von Herbert Lederer, das Theater am Schwedenplatz. Er gründete das Theater 1970 und hatte maximal eine Mitarbeiterin, seine Ehefrau, die Schauspielerin Erna Perger.
Eine alte Ansicht des Hauses findet sich hier: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei:Franz_Josefs_Kai21.jpg
Vorgängerhaus
Den Namen hatte das Haus von einem seiner Besitzer, dem Hans von Ofen, "den man auch Küssenpfenning nennt" (eine Anspielung auf seinen Geiz), der 1404 bis 1430 hier gewohnt hatte. 1470 scheint erstmals ein Hausschild mit dem Namen auf, damals verbaute Kaspar Zeitl zwei kleine alte Häuser zu einem neuen.
1700 war das Haus in Besitz des Wirten Gregor Farnwanger, 41 Jahre später scheint auf, dass das ehemalige Haus mit Turm einem Neubau weichen musste.
Im Nebengebäude war ab 1804 die Kapelle für "griechische fremde Untertanen" zu finden, die bis dahin im Steyrerhof gewesen war.
Sagen und Legenden
Einst stand hier das Wirtshaus „Küss den kleinen Pfennig“, das zuvor auch als Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ bekannt war.
Und hier spielte sich eine Legende ab:
| Die Sage vom Küss-den-Pfennig |
|---|
|
Der Wirt des „Schwarzen Adlers“ war als besonders geizig bekannt. Einmal kam spät in der Nacht ein Fremder, der um ein Zimmer bat. Der Wirt wollte ihn schon abweisen, weil er so ärmlich gekleidet war, der Fremde versprach jedoch, ihn reichlich zu belohnen, wenn er bleiben könne. Es stellte sich heraus, dass der Fremde viel länger blieb, es verstrich ein Tag nach dem anderen, und der Wirt bekam kein Geld zu sehen. Und nach dem der Wirt einige Zeit gewartet hatte, fasste er sich eines Tages ein Herz, klopfte an die Zimmertür des Fremden und forderte sein Geld ein. Der Fremde sagte, er habe im Moment kein Geld, aber er übergab ihm einen Kupferpfennig, mit dem Versprechen, ihm den Rest ein andermal zu geben. Der Wirt schleuderte zornig die Münze zu Boden und wollte die Wache holen. Da lächelte der Gast und meinte: „Ich würde den Pfennig an deiner Stelle nicht so einfach wegwerfen! Er ist viel wert…“ Der Wirt bückte sich und sah überrascht, dass der Pfennig aus Gold war, und damit viel mehr wert, als der Gast ihm schuldete. Die Geschichte sprach sich wie ein Lauffeuer in Wien herum, die Leute kamen, den Pfennig zu bewundern, und jeder sprach bei einem Glas Wein von dem Wunder und dem Gast, der sich Dr. Paracelsus nannte. Der Wirt wurde bald sehr wohlhabend und nannte sein Wirtshaus „Zum Küssdenpfennig“. |
Das Hauszeichen
Das Hauszeichen zeigte einen Mann, der einen Pfennig küsst, darunter war eine Tafel angebracht, die Folgendes besagte:.
- Der teure Theophrast, ein Alchemist vor Allen,
- Kam einst in dieses Haus und kunnte nicht bezallen
- Die Zech, die er genoß. Er trauet seiner Kunst,
- Mit welcher er gewann viel großer Herren Gunst.
- Ein sicheres Gepräg von schlechtem Wert er nahme,
- Fingierte es zu Gold: der Wirt von ihm bekame
- Dies glänzende Metall. Er sagt, nimm dieses hin;
- Ich zahl' ein Mehreres, als ich dir schuldig bin.
- Der Wirt ganz außer sich, bewundert solche Sache,
- Den Pfennig küsse ich, zu Theophrast er sprache.
- Von dieser Wundergschicht, die in der Welt bekannt.
- Den Namen führt dies Haus, zum Küssenpfennig genannt [1]
Paracelsus
Der Gelehrte, der sich Paracelsus nannte, war eigentlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ein Arzt und Alchemist. Er hatte angeblich ein Mittel gefunden, das jegliches Metall zu Gold verwandelte. Paracelsus war in seiner Zeit ein nicht viel beachteter Arzt, obwohl seine Heilungserfolge überragend waren. Er stellte die „Vier-Säfte-Lehre“ auf, die die Grundlage der modernen Ernährung war und war der Erste, der auf der Universität in Deutsch (und nicht in Latein) unterrichtete. Berühmt wurde er durch seine Erfindung des „Laudanum“ – einer Mixtur aus Opium, Nachtschattenalkoiden, Perlmutt, Froschsperma und Zimt.
Er selbst starb (trotz zahlreicher anders lautender Gerüchte: Man habe ihn vergiftet, man habe ihn einen Felsen hinabgestürzt, er sei in Folge seines Alkoholkonsums an Leberkrebs gestorben bzw. er sei im Rausch eine Treppe herunter gestürzt und so fort) an eine Quecksilbervergiftung. Heute ist der höchste Preis, der in Deutschland an verdiente Ärzte vergeben wird, die Paracelsus-Medaille, und in Salzburg (hier lebte P. lange) wird der Paracelsus-Ring der Stadt Salzburg für hervorragende wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen verliehen.
Ausgrabungen
| Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |
|---|---|---|
| 187402 | römisch | 1874 wurde die Hochquellenwasserleitung errichtet. Am Ausgang der ehemaligen Adlergasse in die Rotenturmstraße bis zum Laurenzerberg, stieß man bei den Arbeiten auf eine römische Mauer, die an ihren Endpunkten aus großen Steinblöcken bestand |
Theater
Im Haus befindet sich eine kleines Theater, das "Theater Franzjosefskai21". [2] Um 20 €pro Karte können hier unter der Regie von Alexander Wächter heitere Abende genossen werden.[3]
Jüdische Schicksale
Das Haus "Adlergasse 4" wurde in der NS-Zeit für "Sammelwohnungen" genutzt - zwangsenteigneten Juden wurden hier kurz Quartier geboten, bevor sie in Konzentrationslager deportiert wurden. Da die Wohnungswechsel häufig waren, und an der gleichen Adresse viele Familien gemeldet waren, entstand der Name "Sammelwohnung".
Ein Verzeichnis der jüdischen Bewohner kann auf der Seite https://www.memento.wien/address/1/ abgerufen werden.
Stein der Erinnerung
In der Straße sind Steine der Erinnerung eingelassen.
Gehe weiter zu Griechengasse 4 | Franz-Josefs-Kai 23
Gehe zurück zu Griechengasse | Franz-Josefs-Kai | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ A. Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 63
- ↑ https://franzjosefskai21.at/
- ↑ https://wienerbezirksblatt.at/hofnarr-am-franz-josefs-kai/