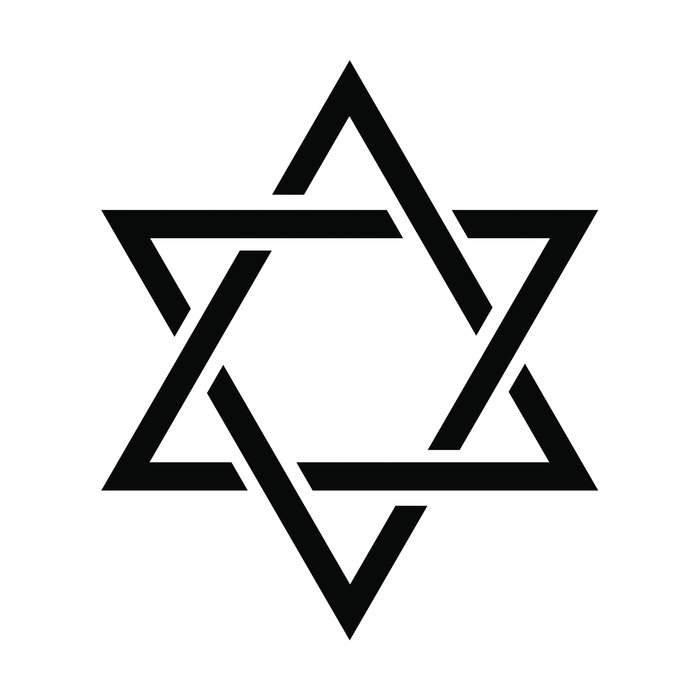Judenplatz 9: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="5" cellpadding="2" style="border-color:#640064; border-width:2px;border-style:dashed;background-color:#ffffff;text-align:left;width:…“) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| class="prettytable" width="100%" | ||
| | |- bgcolor="#B40404" | ||
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||
| | !<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | ||
|- | |||
| | | style="background-color:#dedede" | [[File:Haus-Wipplingerstraße 13-01.jpg|200px|center]] | ||
| style="background-color:#dedede" | | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||
|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[ | |style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Judenplatz]] 9, =[[Wipplingerstraße]] 13 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | vor 1862: 344 | vor 1821: 374 | vor 1795: 274 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | | |style="background-color:#f1f1f1;" | 1883 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | | |style="background-color:#ffffff;" | Adolf Endl, Anton Honus | ||
|} | |||
|} | |} | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
== Das Haus - Architektur und Geschichte == | == Das Haus - Architektur und Geschichte == | ||
Das Haus wurde 1883 nach Entwürfen von Adolf Endl (dem damaligen Besitzer des Hauses) und Anton Honus erbaut. | |||
<ref> | |||
== | 1905 besaß das Gebäude die "österreichischen Central Boden Kreditbank", ab 1914 befand es sich in jüdischem Privatbesitz, was zur Folge hatte, dass es 1942 vom Deutschen Reich beschlagnahmt wurde. Erst ein Rückstellungsverfahren bewirkte die Rückgabe im Jahr 1947. | ||
== Vorgängerhäuser == | |||
[[File:Judenstern.jpg|90px|left]]In der Zeit der Judenstadt standen hier die beiden wichtigsten Häuser, die Judenschule ("Schola Judeorum", 1204 erstmals erwähnt) und das Judenspital. Das Spital verband in Form eines Durchhauses den Schulhof mit der Wipplingerstraße. Als die Juden vertrieben wurden, fiel das Haus in den Besitz der Stadt Wien, die es 1424 verkaufte. Bis ins 18. Jahrhundert hieß das Haus jedoch "haus, das weilent der Juden Spital gewesen". | |||
Dokumentiert ist auch, dass 1458 das Haus in Besitz der Familie Een kam, gekauft hatte es Hans, der es 1480 seinem Sohn Stefan, Bürgermeister von Wien, vererbte. | |||
Um 1700 trug das Haus den Namen "Zum holländischen Wappen". 1801 kaufte es der Fuhrwerksunternehmer Joseph Jantschky (siehe auch [[Am Gestade 2-4]]). Die Eigentumsverhältnisse zersplitterten später stark, einer darunter war der Architekt August Sicard von Sicardsburg.<ref>Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 68</ref> | |||
== Steine des Gedenkens == | |||
{| class="wikitable"width="100%" | |||
!colspan="4"|Steine der Erinnerung | |||
|- | |||
|rowspan="3"|[[File:Erinnerungsstein für Alexander, Leon und Broncia Nagler.JPG|center|250px]] <br /> | |||
|- | |||
|rowspan="2"| Sammelwohnungen in der NS-Zeit | |||
|Zum Gedenken <br /> | |||
an eine Familie, <br /> | |||
die in diesem <br /> | |||
Hause wohnte<br /> | |||
und von den <br /> | |||
Nazis ermordet <br /> | |||
wurde.<br /> | |||
| Alexander <br /> | |||
Nagler<br /> | |||
25.8.1904<br /> | |||
<br /> | |||
1943 von Drancy<br /> | |||
nach Ausschwitz<br /> | |||
deportiert<br /> | |||
am 2.1.1944<br /> | |||
ermordet<br /> | |||
|- | |||
| Leon <br /> | |||
Nagler<br /> | |||
23.01.1868r<br /> | |||
<br /> | |||
Am 30.3.1943<br /> | |||
nach Theresienstadt<br /> | |||
deportiert<br /> | |||
Tod am 19.4.1943<br /> | |||
| Broncia<br /> | |||
Nagler<br /> | |||
1.6.1878<br /> | |||
<br /> | |||
Am 30.3.1943<br /> | |||
nach Theresienstadt<br /> | |||
deportiert<br /> | |||
in Ausschwitz-<br /> | |||
Birkenau ermordet<br /> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:xxx.jpg|250px]] | |||
| 8 Opfer der NS-Zeit | |||
| Elsa Just, geb. Reismann<br /> | |||
Geboren am 02. 08. 1892<br /> | |||
Am 31. 08. 1942 <br /> | |||
nach Maly Trostinec deportiert<br /> | |||
Am 04.09. 1942 ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Sandor Just<br /> | |||
Geboren am 26. 12. 1885<br /> | |||
Am 31. 08. 1942 <br /> | |||
nach Maly Trostinec deportiert<br /> | |||
Am 04. 09. 1942 ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Rifka Margosches, geb. Herzan<br /> | |||
Geboren am 11. 03. 1878<br /> | |||
Am 17. 08. 1942 <br /> | |||
nach Maly Trostinec deportiert<br /> | |||
Am 21. 08. 1942 ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Helene Wang, geb. Blaustein<br /> | |||
Geboren am 16. 06. 1881<br /> | |||
Am 11. 01. 1942 <br /> | |||
nach Riga deportiert<br /> | |||
Im Holocaust ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Dr. Wilhelm Schieber; Apotheker<br /> | |||
Geboren 21. 05. 1875<br /> | |||
Am 24. 09. 1942 <br /> | |||
nach Theresienstadt deportiert<br /> | |||
Am 04. 12. 1942 ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Sophie Schieber, geb. Jurowicz<br /> | |||
Geboren am 09. 06. 1882<br /> | |||
Deportiert nach Theresienstadt<br /> | |||
Überlebte<br /> | |||
<br /> | |||
Regine Kinsbrunner, geb. Weiss<br /> | |||
Geboren am 11. 02. 1886<br /> | |||
Am 11. 01. 1942 <br /> | |||
nach Riga deportiert<br /> | |||
Im Holocaust ermordet<br /> | |||
<br /> | |||
Edmund Kinsbrunner<br /> | |||
Geboren am 21. 01. 1879<br /> | |||
Am 11. 01. 1942 <br /> | |||
nach Riga deportiert<br /> | |||
Im Holocaust ermordet<br /> | |||
|} | |||
== Ausgrabungen == | |||
Gehe | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
|- class="hintergrundfarbe29" | |||
! Adresse | |||
! Ausgrabungscode <ref>https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll</ref> | |||
! zeitliche Lagerung | |||
! Beschreibung der Fundstücke | |||
|- | |||
| Judenplatz 9 | |||
| 189711 | |||
| römisch | |||
| Im Jahr 1897 wurden vermutlich bei Arbeiten für die Gasrohrverlegung zahlreiche römische Ziegelbruchstücke gefunden | |||
|} | |||
---- | |||
Gehe weiter zu [[Judenplatz 10]] | [[Wipplingerstraße 14]] | |||
Gehe zurück zu [[Judenplatz]] | [[Wipplingerstraße]] | [[Straßen des 1. Bezirks]] | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Architekten: | [[Kategorie:Architekten:Adolf Endl]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Architekten:Anton Honus]] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Steine des Gedenkens]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Ausgrabungen]] | |||
[[Kategorie:1. Bezirk - Vorgängerhäuser]] | |||
[[Kategorie:Jüdisches Wien]] | |||
== Quellen== | |||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2021, 17:39 Uhr
| Haus: Judenplatz 9 | Grund-Informationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Haus wurde 1883 nach Entwürfen von Adolf Endl (dem damaligen Besitzer des Hauses) und Anton Honus erbaut.
1905 besaß das Gebäude die "österreichischen Central Boden Kreditbank", ab 1914 befand es sich in jüdischem Privatbesitz, was zur Folge hatte, dass es 1942 vom Deutschen Reich beschlagnahmt wurde. Erst ein Rückstellungsverfahren bewirkte die Rückgabe im Jahr 1947.
Vorgängerhäuser
In der Zeit der Judenstadt standen hier die beiden wichtigsten Häuser, die Judenschule ("Schola Judeorum", 1204 erstmals erwähnt) und das Judenspital. Das Spital verband in Form eines Durchhauses den Schulhof mit der Wipplingerstraße. Als die Juden vertrieben wurden, fiel das Haus in den Besitz der Stadt Wien, die es 1424 verkaufte. Bis ins 18. Jahrhundert hieß das Haus jedoch "haus, das weilent der Juden Spital gewesen".
Dokumentiert ist auch, dass 1458 das Haus in Besitz der Familie Een kam, gekauft hatte es Hans, der es 1480 seinem Sohn Stefan, Bürgermeister von Wien, vererbte.
Um 1700 trug das Haus den Namen "Zum holländischen Wappen". 1801 kaufte es der Fuhrwerksunternehmer Joseph Jantschky (siehe auch Am Gestade 2-4). Die Eigentumsverhältnisse zersplitterten später stark, einer darunter war der Architekt August Sicard von Sicardsburg.[1]
Steine des Gedenkens
| Steine der Erinnerung | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| Sammelwohnungen in der NS-Zeit | Zum Gedenken an eine Familie, |
Alexander Nagler | |
| Leon Nagler |
Broncia Nagler | ||
Ausgrabungen
| Adresse | Ausgrabungscode [2] | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |
|---|---|---|---|
| Judenplatz 9 | 189711 | römisch | Im Jahr 1897 wurden vermutlich bei Arbeiten für die Gasrohrverlegung zahlreiche römische Ziegelbruchstücke gefunden |
Gehe weiter zu Judenplatz 10 | Wipplingerstraße 14
Gehe zurück zu Judenplatz | Wipplingerstraße | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 68
- ↑ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/searching/search.aspx?__jumpie#magwienscroll