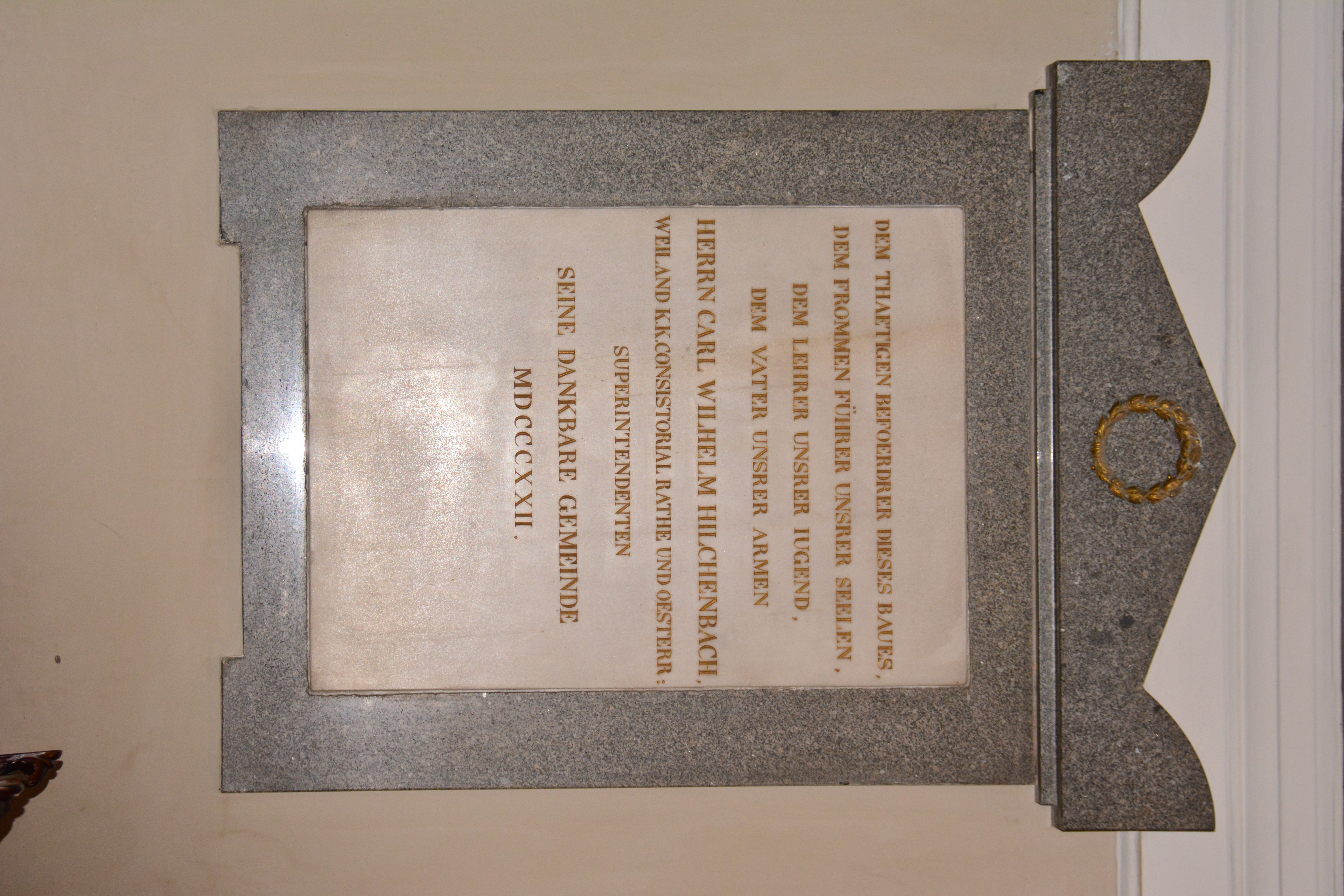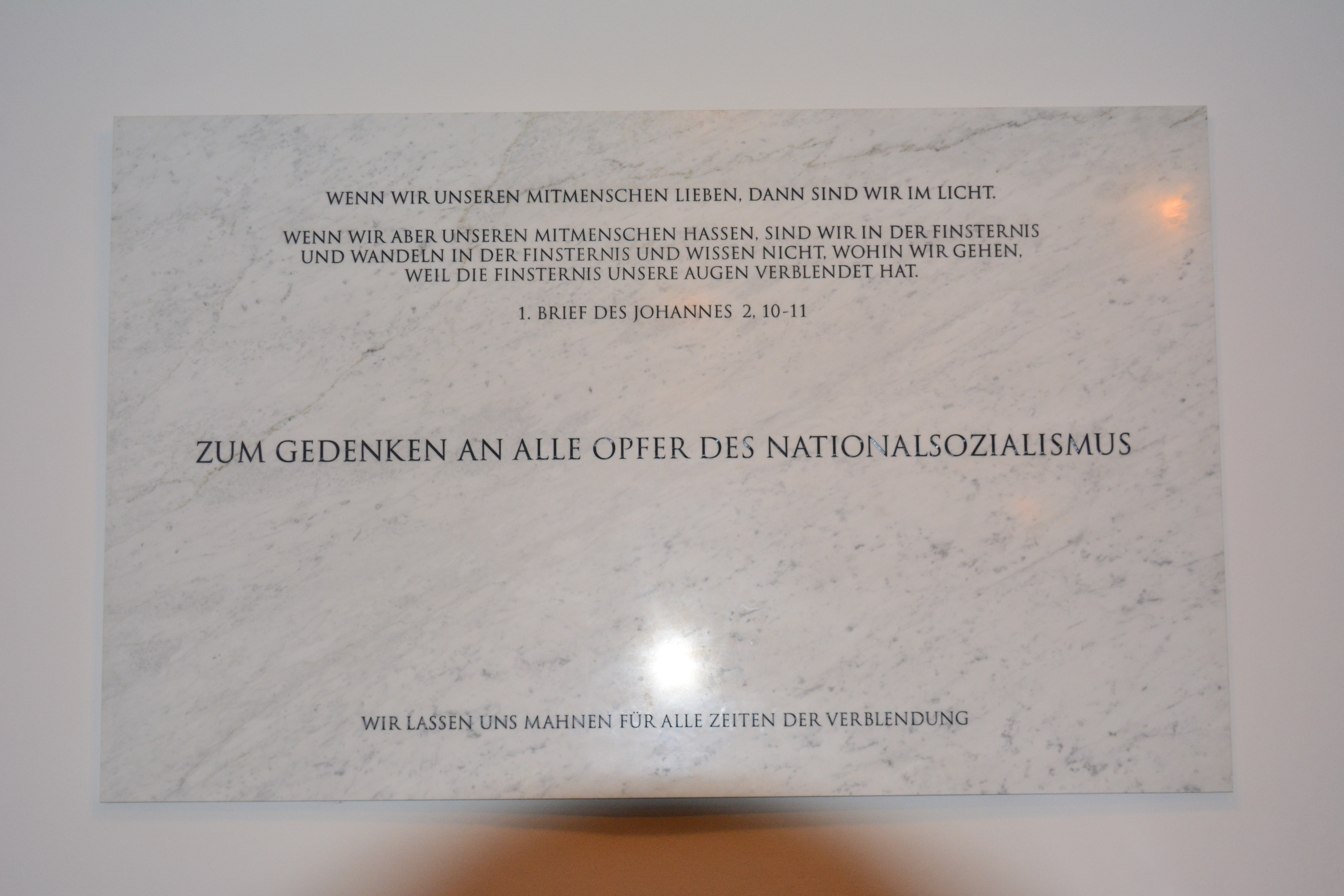Dorotheergasse 18
(Weitergeleitet von Lutherkirche)

- Bezirk
1., Innere Stadt
- Aliasadressen
- =Dorotheergasse 18
- Ehem. Konskriptionsnummer, Stadt
- vor 1862: 1113
- vor 1821: 1179 |
- vor 1795: 1347
- Konfession
- evangelisch
- Baujahr
- 1582/1583 / Umbau: 1783, Umbau 1867, Umbau: 1907
- Architekten (Umbau)
- Pietro Ferrabosco / Umbau: Adalbert Hild, Umbauten: Ludwig Schöne, Otto Thienemann
- Auf einen Blick
- Neoklassizistische Fassade (1907/1989)
- Saalkirche mit Emporen
- ohne Turm
- ehem. Königinkloster (1583)
Lutherkirche und Pfarrhaus der evangelischen Kirche und Evangelische Kirche - Architektur und Geschichte
Die Lutherische Stadtkirche liegt in der Dorotheergasse gegenüber dem Dorotheum, neben der Reformierten Stadtkirche (H.B.). Die Saalkirche mit kreuzförmigem Grundriss und umlaufenden Emporen zeigt heute eine neoklassizistische Straßenfront mit Dreiecksgiebeln und Glockengeschoss, jedoch ohne Turm.[1]
Bereits 1582 wurde der Grundstein für das Königinkloster gelegt. Erzherzogin Elisabeth, die verwitwete Königin von Frankreich, hatte hier das Klarissen-Kloster und die Klosterkirche St. Maria Königin der Engel gestiftet.
1781 hob Joseph II. im Zuge des Toleranzedikts die Klöster auf und ermöglichte so der ersten evangelischen Gemeinde die Eröffnung einer eigenen Kirche: Die Lutherische Stadtkirche wurde am 1. Adventsonntag 1783 mit einer feierlichen Messe eröffnet.
Die Entstehung des Königinklosters
Das Areal hatte im frühen 16. Jahrhundert dem Grafen Salm gehört.
Nikolaus Salm (sein Denkmal steht im Ratshauspark) hatte während der ersten Türkenbelagerung für Wien gekämpft. Dabei traf ihn am 24.10.1529 am Oberschenkel ein Stein, der sein Bein zerschmetterte. Im Frühjahr 1530 starb Salm an den Folgen dieser Verletzung und hiterließ das Grundstück seinem Erben Hector von Salm. Dieser verkaufte es 1559 an Kaiser Ferdinand I. um 6500 Pfund Pfennige. 1582 erwarb Erzherzogin Elisabeth schließlich vom Kaiser das Grundstück.
- Innenansichten
Erzherzogin Elisabeth
Elisabeth wurde am 5.7.1554 als zweite Tochter von Kaiser Maximilian II. geboren. Schon früh betreute sie Arme und Kranke, galt aber auch als besonders schöne Frau und war daher am royalen Heiratsmarkt sehr begehrt. 1570 fand in Speyer die Absprache ihrer Heirat mit König Karl IX. statt, die Verhandlungen führte ihr Onkel, Erzherzog Ferdinand von Tirol. Als Verhandlungsergebnis erhielt Österreich die Saliera von Benvenuto Cellini, eine Kanne aus Onyx und den Michaelsbecher, die heute im Kunsthistorischen Museum ausgestellt sind. Die Trauung selbst erfolgte 1570 in Frankreich.
Die Ehe dauerte nicht lange an - Karl starb am 30.5.1574 an einer Tuberkulose. Er hatte die Gräuel und Mordszenen der „Bartholomäusnacht“ (24. August 1572) nie verwunden und starb geschwächt unter der fürsorglichen Pflege Elisabeths. Nachdem auch ihre fünfjährige Tochter am 2.4.1578 gestorben war, und sie in Frankreich nichts mehr hielt, ließ sie sich in Prag nieder um die "Allerheiligenkapelle" am Hradschin zu erbauen. Schon zu diesem Zeitpunkt dürften die Pläne für die Erbauung des Klosters in Wien entstanden sein. Bei Elisabeths Rückkehr nach Wien 1581 wählte sie als künftigen Standort das ehemalige St. Klara-Kloster, das in der Zeit der Türkenbelagerung zerstört worden war. Das große Areal umfasst Grundstücke, die sich zwischen Augustinerstraße, Bräunerstraße, Stallburggasse und Dorotheergasse erstreckten.
Das Klarissen-Kloster
Die ersten sieben Nonnen kamen 1580 nach Wien und zogen bereits in das Kloster ein. Der Orden unterstand den Franziskanern, aus deren Orden der Beichtvater gewählt wurde. Die Klarissen wurden als Orden schon 1212 von Klara von Assisi gegründet. Sie lebten eigentlich nach strengen eigenen Regeln ("Klara-Regeln"), in Wien wurden diese jedoch nicht so eng gesehen: Man durfte gemeinsamen Besitz haben.
Die Erbauung der Kirche "Maria, Königin der Engel", später Lutherkirche
Am 5.3.1582 wurde der Grundstein der Kirche gelegt und vom Bischof Wiens, Johann Kaspar Neubeck, gesegnet. "In jener Ecke, mit der das künftige Gotteshaus an der Königin Haus anstoßen sollte", wurde eine silberne Gedenkmünze Elisabeths in acht Metern Tiefe mit vergraben. Bestellter Baumeister war Pietro Ferabosco, der seit 1455 im Dienst des Kaisers stand und auch die Amalienburg ausgebaut hatte. [2]
Mysteriöses Bild
Elisabeth hatte ihr Lieblingsbild, eine Kopie der "Maria maior" (Lukasbild) aus der Santa Maria Maggiore in Rom, in der Kirche integrieren lassen: Es wurde in Silber gefasst und war Teil des Altars. Heute ist es in der Augustinerkirche. Zur Zeit Elisabeths hatte das Bild für die Habsburger eine besondere Bedeutung: Das Gesicht der Maria soll bei bedrohlichen Ereignissen für die Familie Habsburg erblasst sein.
Reliquien
1588 organisierte Elisabeth, dass Haupt und Gebeine der Heiligen Elisabeth von Thüringen in das Klarissen-Kloster verlegt wurden. 200 Jahre lang wurden die Reliquien hier aufbewahrt, heute sind sie im Kloster St. Elisabeth an der Landstraße Hauptstraße im 3. Bezirk verwahrt.
Ein weiteres Reliquiar ist das des rechten Beckenknochens vom Heiligen Leopold (Markgraf Leopold III. von Österreich). Es wurde in einem Schrein mit metallgetriebenen Flügelreliefs gebettet und befindet sich heute in der Schatzkammer des Dom-Museums.
Tod und Bestattung Elisabeths
Am 22.1.1592 starb Elisabeth 37-jährig. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie in einem schlichten hölzernen Sarg am 9.2.1592 in der Kirche beigesetzt. Die Predigt hielt Melchior Khlesl. Als 1762 der Altar renoviert wurde, wurde ihr Leichnam gefunden. Man verlegte ihn in die damals erbaute Krypta, nach Aufhebung des Klosters wurde sie in die Fürstengruft des Stephansdoms verlegt. Der Sarg kann heute noch dort besichtigt werden.
Herzbecher
1619 bzw. 1618 wurden auch der Bruder Elisabeths, Kaiser Matthias, und seine Frau Anna in der Kirche bestattet. 1631 wurden ihre Särge, in Begleitung von Kaiser Ferdinand II., in die neue Kapuzinergruft verlegt. Was jedoch in der Kirche blieb, waren die Herzen von Matthias und seiner Frau (und später auch Ferdinand II.). Sie wurden in Silberbechern, links und rechts vom Hochaltar, hinter Tafeln aus rotem Marmor vermauert. Die Tafeln gibt es heute noch, die Becher wanderten 1782 in die Augustinerkirche.
Einzug der Evangelischen Glaubensgemeinschaften
Die Entscheidung von Joseph II., "sämtliche unnütze Klöster aufzuheben", führte dazu, dass sämtliche Bauten mangels Käufer des riesigen Areals an den Magistrat zur Versteigerung abgetreten wurden. Den Zuschlag für die Parzelle 2, nämlich die Kirche und einen Teil des Pfarrhauses, erhielt die Evangelische Gemeinde A.C., die Reformierten erlangten den Besitz der Parzelle 3: Die "Akatholiken" hatten von Joseph II. die Erlaubnis erhalten, sich an der Versteigerung zu beteiligen.
Auf dem Rest des Areals steht heute das Palais Pallavicini, das von Hofarchitekt von Hohenberg für Graf Fries erbaut wurde.
Umbauarbeiten und neue Innenausstattung
Kaiser Joseph II. verlangte bei Übernahme durch die Evangelische Gemeinde, dass die drei Kirchtürme abgetragen werden müssten, ebenso durfte die Kirche nicht von der Straße aus begehbar sein. Zudem verlangte der Graf von Fries, dass die Außenmauer der Kirche abgerissen werden müsse, da sie sich bereits auf dessen Grundstück befand.
Es wurden also große Umbauarbeiten notwendig, die der Baumeister Adalbert Hild übernahm. Die Kirche selbst wurde durch ein zweistöckiges Haus verdeckt, das als Schule genutzt wurde. Die Orgel wurde aus dem aufgelassenen Nikolaikloster in der Singerstraße übernommen und renoviert. Der Altar wurde von Bildhauer Khol geschaffen, er wurde aus Holz gefertigt, das Altarbild wird von zwei Marmorsäulen umrahmt. Das Altarbild selbst schuf Franz Linder, er kopierte dafür die "Kreuzigung Christi" von A. Van Dyck.
Die Kirche wurde mit einem feierlichen Gottesdienst am 30.11.1783 eröffnet.
1876 wurde die Kirche durch Otto Thienemann renoviert. Dabei wurde die Fassade umgestaltet, und die Kirche als Solche wieder kenntlich gemacht. Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche erst 1907. Damals war in der Altlerchenfelder Kirche eine Panik entstanden, die zu feuerpolizeilichen Auflagen führte.
- Die Kirche innen
Die Kirche heute, Innenausstattung
- Altarbild und Chorgestühl
- Das Hochaltarbild wurde 1783 von Franz Linder geschaffen: Christus am Kreuz nach van Dyck; geschnitztes Chorgestühl von 1876.
- Taufbecken
- Taufbecken auf Säule aus Stucco lustro, seit 1822 in der Kirche.
- Emporen und Erinnerungsstücke
- Umlaufende Emporen; im hinteren Bereich marmorne Verschlussplatten ehemaliger Herzbestattungen (Kaiserin Anna, Kaiser Matthias, Kaiser Ferdinand II.; später in die Loretokapelle der Augustinerkirche überführt). Gedenktafeln für Caspar Tauber und Kaiser Joseph II.
- Glocken
- Zwei Bronzeglocken (Gießerei Pfundner): Friedensglocke dis″ (1955, 159 kg, Ø 65 cm) und Vaterunserglocke fis″ (1959, 96 kg, Ø 54 cm).
- Orgel
Orgelgehäuse Friedrich Deutschmann (1808); Neubau/Rekonzeption 2017–2018 durch Orgelbau Markus Lenter. Mechanische Spieltraktur (III/P), 37 Register + 1 Extension (Physharmonika-Konzept), Manuale C–a³, Pedal C–f¹; Disposition mit u. a. Physharmonika 16′/8′, Vox humana 8′, Fagott 16′. Das Instrument wurde individuell für den Raum konzipiert.[3][4][5]
Öffnungszeiten und Gottesdienste
- Adresse: Dorotheergasse 18, 1010 Wien (Innere Stadt).[6]
- Gottesdienste: Jeden Sonntag und evangelische Feiertage 10:00 Uhr (Deutsch); Abendmahl i. d. R. am 1. und 3. Sonntag sowie an Feiertagen
- Barrierefrei: Kirche und Raum der Begegnung sind barrierefrei zugänglich.[7]
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Wohn- und Sterbehaus Erich Adolf Johanny
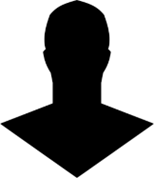 |
Name der Persönlichkeit: Erich Adolf Johanny |
Im Pfarrhaus wohnte der evangelische Theologe Erich Adolf Johanny (* 29. Mai 1861 Pleß, Preußisch-Schlesien (heute Polen), † 6. März 1912). Johanny war der erste evangelische Pfarrer Wiens, er hielt seine Messen in der Lutherkirche im 18. Bezirk ab. Ab 1901 war er Pfarrer und bekannter Prediger der Inneren Stadt.
Gedenktafeln
Erbauung der Kirche
Gedenk Tafel
Dieses im Jahre 1784 nach dem Toleranz-Edikt
erbaute Gotteshaus wurde unter der Regierung des
Kaisers Franz Josef I
im Jahre 1887 zur Kirche umgestaltet
und der angrenzende Pfarrhof renoviert.
Dies geschah durch die opferwilligen Spenden
der Gemeinde wozu Herr
Alexander Ritter von Schoeller
den ersten Beitrag leistete.
Die Grundidee zu der Umgestaltung gab Presbyter
Heinrich Adam
Zu dieser Zeit wirkten als Pfarrer:
Dr. C.A. Witz und
O. Schack
Kurator Dr. C. Brunner von Wattenwyl
Obmann des Bau-Comite: Franz Bollinger
Architekt: Ignaz Sowinski
Seelsorger, Pfarrer und Nonnen

In diesem Gotteshause
wirkte
Alfred Formey
von 1876-1901 als treuer Seelsorger.
Dem Todten zur Ehre
den Lebenden zur Mahnung
den Kommenden zur Nacheiferung.
Gewidmet von seinen Freunden.
Die evangelische Gemeindeschwester
Elisabeth Szüts
hat im Jahre 1956
mit heldenhafter Aufopferung
den Ungarnflüchtlingen geholfen
in Dankbarkeit
Dem tätigen Beförderer dieses Hauses
Dem frommen Führer unserer Seelen
dem Lehrer unserer Jugend
dem Vater unserer Armen
Herrn Carl Wilhelm Hilchenbach
Weiland k.k. Konsistorial Rate und österr.
Superintendeten
seine dankbare Gemeinde
MDCCCXXII.
Dem Andenken
an den ersten Blutzeugen der
Reformation in Österreich
Kaspar Tauber
enthauptet in Wien
am 17. September 1524
gewidmet
1924
"Gedenket an eure Lehrer
die Euch das Wort Gottes gesagt haben"
(Hebräer 13.7)
Georg Traar
(1899 - 1980)
Pfarrer dieser Gemeinde
und
Superidentenden der Diözese Wien
Kriegsopfer und Opfer der NS.Zeit
Gedenktafel
In dankbarer Erinnerung
an treue Pflichterfüllung
während des Weltkrieges
1914 - 1918
und zur Ehrung auf dem
Schlachtfelde gefallenen
Gemeindemitglieder. Mögen
kommende Geschlechter
nicht vergessen, dass Friede
der Menschheit höchstes
Gut ist.
Der Gerechtigkeit Frucht
wird Friede sein. Jes. 32.17
Die Wiener reform.
Kirchengemeinde
1925
Zsigmond Varga
Pfarrer der
reformierten Ungarn in Wien
+ 1945 in Gusen / Mauthausen
Ernst und Gisela Pollack
große Wohltäter
unserer Pfarrgemeinde
+ 1942 in Theresienstadt
Ihre Namen stehen für viele
Frauen und Männer unserer Kirche,
die in den Konzentrationslagern
der Nationalsozialisten
ermordet worden sind.
"Wir aber gehören nicht zu denen,
die zurückweichen und verloren gehen
sondern zu denen,
die glauben und das Leben gewinnen.
Hebräerbrief 10/39
Evangelische Pfarrgemeinde H.B.
Wien Innere Stadt
2005
Wenn wir unseren Mitmenschen lieben, dann sind wir im Licht.
Wenn wir aber unseren Mitmenschen hassen, sind wir in der Finsternis
und wandlen in der Finsternis und wissen nicht, wohin wir gehen.
Weil die Finsternis unsere Augen verblendet hat.
1. Brief des Johannes 2. 10-11
Zum Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus
Wir lassen uns mahnen für alle Zeiten der Verblendung
Weiter zur Nachbarin: Dorotheergasse 16 ·
Zurück zur Übersicht: Kategorie:1. Bezirk - Kirchen · Dorotheergasse ·
Quellen
- ↑ Wikipedia: Lutherische Stadtkirche (Wien), Lage und Architektur
- ↑ Leopold Mazakarini: Verschwundene Klöster der Innenstadt, Gesellschaft für Natur- und Heimatkunde, Wien, 1990, S. 16-17
- ↑ Organ index: Wien/Innere Stadt – Lutherische Stadtkirche (AB).
- ↑ Orgelbau Lenter: Orgelneubau Lutherische Stadtkirche Wien (III/37)..
- ↑ Stadtkirche.at: Allgemeines zu unserer Orgel.
- ↑ Stadtkirche.at: Start/Kontakt.
- ↑ Stadtkirche.at: Gottesdienstplan & Zeitung.