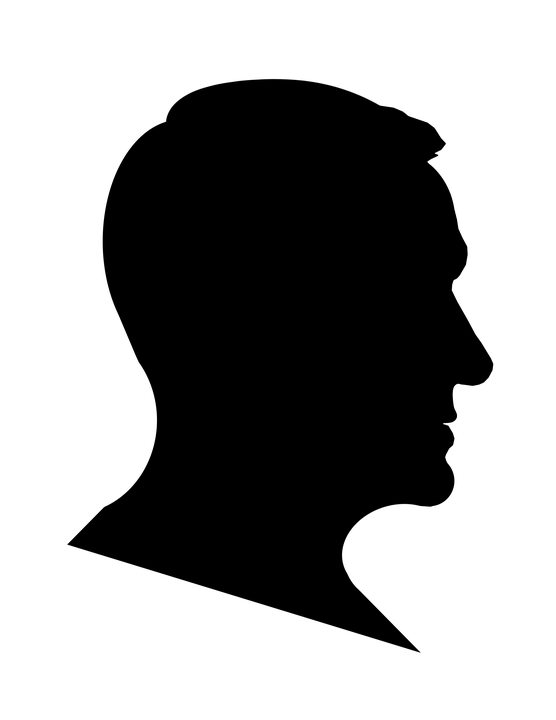Riemergasse 1-3: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<mockingbird.Aside no-header> | |||
<mockingbird.header #header:#a80f11>Das Gebäude</mockingbird.header> | |||
<mockingbird.image wiki="Riemergasse1-1.jpg" /> | |||
<mockingbird.content> | |||
;Bezirk | |||
: 6., Mariahilf | |||
;Aliasadressen | |||
: =[[Riemergasse]] 1-3 | |||
: =[[Wollzeile]] 28 | |||
; Konskriptionsnummer | |||
: vor 1862: '''793,794 ''' | |||
: vor 1821: '''840, 841''' | |||
: vor 1795: '''834, 835''' | |||
; Baujahr | |||
: 1900 | |||
; Architekten (Bau) | |||
: [[Julius Deininger]], [[Albert Hans Pecha]] | |||
</mockingbird.content> | |||
<mockingbird.map coordinates="48.20776903122456, 16.377368013782778"> | |||
<mockingbird.on-map coordinates="48.20776903122456, 16.377368013782778" type="marker" /> | |||
</mockingbird.map> | |||
<mockingbird.content-license license="cc-by-sa" /> | |||
</mockingbird.aside> | |||
__TOC__ | |||
== Architektur und Geschichte == | == Architektur und Geschichte == | ||
Das heutige Gebäude Ecke Wollzeile / Riemergasse wurde nach Plänen von Julius Deininger von Albert Hans Pecha schließlich durch den Architekten Carl Wanitzky 1900 erbaut. <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/84.htm</ref>, <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/674.htm</ref> | Das heutige Gebäude Ecke Wollzeile / Riemergasse wurde nach Plänen von Julius Deininger von Albert Hans Pecha schließlich durch den Architekten Carl Wanitzky im Jahr 1900 erbaut. <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/84.htm</ref>, <ref> http://www.architektenlexikon.at/de/674.htm</ref> | ||
== Vorgängerhäuser == | == Vorgängerhäuser == | ||
| Zeile 40: | Zeile 65: | ||
=== Das scharfe Eck === | === Das scharfe Eck === | ||
Kurz danach galt schon ein neuer Name, nämlich: „Am scharfen Eck“, der sich daraus begründete, dass der Verkehr hier stark war und die | Kurz danach galt schon ein neuer Name, nämlich: „Am scharfen Eck“, der sich daraus begründete, dass der Verkehr hier stark war und die Fahrzeuge scharf um die Kurve kratzten. | ||
== Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten == | == Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten == | ||
[[File:KopfinX.png|75px|left]] Nach 1815 wohnte in diesem Haus die Mutter des Architekten [[Eduard van der Nüll]], Theresia. | |||
Nach 1815 wohnte in diesem Haus die Mutter des Architekten [[Eduard van der Nüll]], Theresia. | |||
[[File:KopfX.png|75px|left]] Ab 1836 wohnte [[Johann Baptist Ripelly]] in dem Haus Stadt 793, auch Armen-Bürgerladhaus. Ripelly war ab 1826 Vizebürgermeister.<ref> Felix Czeike: Vizebürgermeisteramt 2. In: Handbuch der Stadt Wien 94. Wien: Verlag für Jugend und Volk 1980, II/S. 29 f.</ref> | |||
[[File:KopfX.png|75px|left]] In dem Gebäude wohnte auch der Historiker [[Ladislaus Sunthaym]] (auch Sunthaim, Sunthain) Ladislaus (* um 1445 Ravensburg, Württemberg, † Anfang Februar 1513 ebenhier). Damals gehörte das Haus 794 zu einer Messstiftung. Der Priester war Mitglied des Domkapitals von St. Stephan und beschäftigte sich vor allem mit Genealogie - unter anderem mit der der Habsburger. Zwischen 1485 und 1489 erstellte er auch eine Genealogie der Babenberger. Ab 1511 war Sunthaym Mitglied der Fronleichnamsbruderschaft bei St. Stephan. | |||
In dem Gebäude wohnte der Historiker [[Ladislaus Sunthaym]] (auch Sunthaim, Sunthain) Ladislaus (* um 1445 Ravensburg, Württemberg, † Anfang Februar 1513 ebenhier). Damals gehörte das Haus 794 zu einer Messstiftung. Der Priester war Mitglied des Domkapitals von St. Stephan und beschäftigte sich vor allem mit Genealogie - unter anderem mit der der Habsburger. Zwischen 1485 und 1489 erstellte er auch eine Genealogie der Babenberger. Ab 1511 war Sunthaym Mitglied der Fronleichnamsbruderschaft bei St. Stephan. | |||
== Lokale == | == Lokale == | ||
| Zeile 88: | Zeile 85: | ||
== Ausgrabungen == | == Ausgrabungen == | ||
{| class=" | {| class="toccolours sortable" | ||
|- | |- style="background:#fff8dc;" | ||
! Ausgrabungscode | ! Ausgrabungscode | ||
! zeitliche Lagerung | ! zeitliche Lagerung | ||
! Beschreibung der Fundstücke | ! Beschreibung der Fundstücke | ||
|- | |- | ||
| 190616 | | 190616 | ||
| römisch | | römisch | ||
Version vom 6. März 2024, 08:43 Uhr
| Haus: Riemergasse 1-3 | Grund-Informationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

- Bezirk
- 6., Mariahilf
- Aliasadressen
- =Riemergasse 1-3
- =Wollzeile 28
- Konskriptionsnummer
- vor 1862: 793,794
- vor 1821: 840, 841
- vor 1795: 834, 835
- Baujahr
- 1900
- Architekten (Bau)
- Julius Deininger, Albert Hans Pecha
Architektur und Geschichte
Das heutige Gebäude Ecke Wollzeile / Riemergasse wurde nach Plänen von Julius Deininger von Albert Hans Pecha schließlich durch den Architekten Carl Wanitzky im Jahr 1900 erbaut. [1], [2]
Vorgängerhäuser
Ende des 14. Jahrhunderts hatte das Haus ein Hausschild mit dem Namen „In der Gurgel“. Der Name bezeichnete eine Art von Kapuze, die an einem Mantel befestigt war.
Wo der Hahn den Hühnern predigt
Ab 1660 wurde, ebenfalls nach einem Hausschild, der Name „Allwo der Hahn den Hühnern predigt“ bekannt. Besonders in der Reformationszeit, war es üblich, Menschen als Tiere darzustellen (siehe auch: Wo die Kuh am Brett spielt). Das Bild des Hahns verschwand 1740, als das Haus umgebaut wurde. [3], [4]
In dem Haus war zu dieser Zeit auch ein bekannter Gewürzladen zu finden. [5]
Das scharfe Eck
Kurz danach galt schon ein neuer Name, nämlich: „Am scharfen Eck“, der sich daraus begründete, dass der Verkehr hier stark war und die Fahrzeuge scharf um die Kurve kratzten.
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Nach 1815 wohnte in diesem Haus die Mutter des Architekten Eduard van der Nüll, Theresia.
Ab 1836 wohnte Johann Baptist Ripelly in dem Haus Stadt 793, auch Armen-Bürgerladhaus. Ripelly war ab 1826 Vizebürgermeister.[6]
In dem Gebäude wohnte auch der Historiker Ladislaus Sunthaym (auch Sunthaim, Sunthain) Ladislaus (* um 1445 Ravensburg, Württemberg, † Anfang Februar 1513 ebenhier). Damals gehörte das Haus 794 zu einer Messstiftung. Der Priester war Mitglied des Domkapitals von St. Stephan und beschäftigte sich vor allem mit Genealogie - unter anderem mit der der Habsburger. Zwischen 1485 und 1489 erstellte er auch eine Genealogie der Babenberger. Ab 1511 war Sunthaym Mitglied der Fronleichnamsbruderschaft bei St. Stephan.
Lokale
Santissimo
Der kleine Italiener ist noch nicht lang hier, in dem Geschäftslokal besteht eine hohe Fluktuation.
Das Essen ist okay, die Preise sind gehoben. Getestet wurde die Vorspeisenplatte - sie ist nicht sehr einfallsreich, aber für den kleinen Hunger ausreichend. Die Nudeln sind jedoch hausgemacht, also durchaus zu empfehlen.[7]
Ausgrabungen
| Ausgrabungscode | zeitliche Lagerung | Beschreibung der Fundstücke |
|---|---|---|
| 190616 | römisch | 1906 fand man bei Erdaushebungen für den Neubau des neuen Justizgebäudes im zugeführten Schutt eine römische Münze des Kaisers Philippus I. und zwei unkenntliche Mittelbronzen. |
Shopping
Nebenbei gibt es hier eines der besten Bonbon-Geschäfte Wiens, das Fabienne. Hier erhält man belgisches Konfekt.
Gehe weiter zu Riemergasse 2 | Wollzeile 29
Gehe zurück zu Riemergasse | Wollzeile | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/84.htm
- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/674.htm
- ↑ Richard Groner: Wien wie es war, vollst. neu bearb. von Felix Czeike, Verlag Molden, Wien-München, 1965, 6. Auflage, S. 16
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 55
- ↑ Carl August Schimmer: Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschichtlichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäude, Kuppitsch, 1849, S. 150
- ↑ Felix Czeike: Vizebürgermeisteramt 2. In: Handbuch der Stadt Wien 94. Wien: Verlag für Jugend und Volk 1980, II/S. 29 f.
- ↑ http://www.santissimo.at/index.php