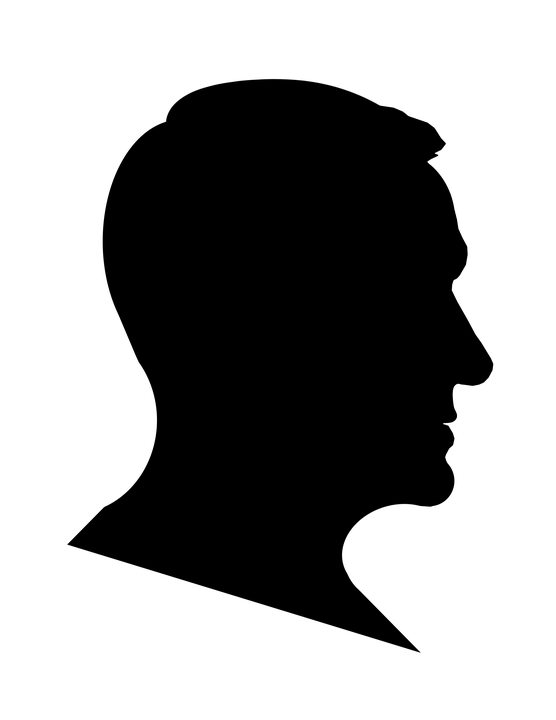Weihburggasse 1
- Bezirk
1., Innere Stadt
- Aliasadressen
- =Kärntner Straße 9
- =Weihburggasse 1
- Konskriptionsnummer Stadt
- vor 1862: 905
- vor 1847: 905
- vor 1821: 961
- vor 1795: 937
- Baujahr
- 1884
- Architekten (Bau)
- Carl Schumann
Das Haus - Architektur und Geschichte
Das Haus wurde 1884 von Carl Schumann erbaut. Im Zweiten Weltkrieg erlitt das Gebäude schwere Schäden durch einen Bombentreffer, konnte aber wieder aufgebaut werden.
Heute sind zwei Etagen des Gebäudes durch die Fa. Nespresso belegt.
Vorgängerhäuser
An dieser Stelle ist bereits ab 1369 eine Bebauung nachweisbar. Ende des 16. Jahrhunderts gehörte es dem Leibarzt von Erzherzog Karl II., Thomas Haunstein. 1627 war das Haus in Besitz eines weiteren Arztes, Johann Wilhelm Mannagetta.
Das Haus hatte zahlreiche Namen, wohl immer nach den Wirtshäusern, die sich darin fanden: "In der Almarein" (1381), "Zur heiligen Dreifaltigkeit" (16. Jhdt.), "Zur Stadt Nürnberg" (hier hatte sich die "Nürnberger-Waren-Handlung" befunden) oder auch "Zum goldenen Rauchfass". [1]
Theyer & Hardtmuth
1736 wurde das Haus neu erbaut, damals gab die Besitzerin Maria Anna Freifrau von Schmidl, geborene Edle von Mühldorf, Gemahlin des Hofkammerrates Christoph Freiherr von Schmidl, den Auftrag, hier ein vierstöckiges Gebäude zu errichten.
Ein Geschäftslokal wurde am 5. Oktober 1763 von Jakob Michael Theyer erworben, der hier das Geschäft "Zur Stadt Nürnberg" eröffnete. Er war der Begründer der späteren Schreibwarenfirma "Theyer & Hardtmuth". Das Geschäft verblieb auch am Standort, als das Haus 1802 neu errichtet wurde, ebenso, als in der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1809 das Haus durch Bomben der Franzosen brannte. [2]
Der traditionsreiche Schreibwarenladen "Theyer & Hardtmuth" war schließlich 273 Jahre lang hier ansässig, bis er Ende Juni 2006 für immer schließen musste.
Zur Schönen Algerierin (Algierin)
Einige Zeit lang hieß das Haus „Zur schönen Algerierin“, weil hier zwischen Oktober 1758 bis zum 1. Mai 1759 ein schönes Mädchen namens Fatime wohnte. Die junge Frau war gemeinsam mit dem algerischen Abgesandten Demetrius Marzachi und dessen Harem nach Wien gekommen. Marzachi war nach der Herstellung des Friedens im Raubstaat Algier nach Wien gekommen, um hier mit dem Kaiser ein Freundschaftsbündnis zu unterschreiben. Offensichtlich blieb Fatime nach der Abreise ihres Herren in Wien zurück, und verursachte zeitgenössischen Berichten zufolge, wenn sie aus dem Fenster sah, ein regelrechtes Verkehrschaos.[3]
Am 1. Mai musste sie daher über behördlichen Auftrag Wien verlassen. Nachher stellte sich dann heraus, dass es sich gar nicht um eine „echte“ Afrikanerin gehandelt hatte - sondern um eine abenteuerlustige Einheimische. Die Hausbezeichnung „Zur schönen Algerierin“ bestand bis 1763.
1802 wurde ein neues Haus erbaut, das durch die Franzosen 1809 in Brand gesetzt wurde. [4]
Zwischen 1875 und 1884 kaufte die Wiener Baugesellschaft das Haus und ließ den heutigen Bau errichten.
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Johann Wilhelm Mannagetta
1627 besaß das Haus der Leibarzt Johann Wilhelm Mannagetta, der später auch das Nebenhaus Kärntner Straße 7 besaß, in dem er starb.
Gehe weiter zu Kärntner Straße 10 | Weihburggasse 2
Gehe zurück zu Kärntner Straße | Weihburggasse | Straßen des 1. Bezirks
Quellen
- ↑ Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1., Kremayr & Scheriau, Wien 1992, S. 56
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/?curid=20425
- ↑ Realis: Curiositaten und Memorabilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler Verlag, Wien, 1846. S. 34
- ↑ Richard Groner: Wien wie es war, vollst. neu bearb. von Felix Czeike, Verlag Molden, Wien-München, 1965, 6. Auflage, S. 15