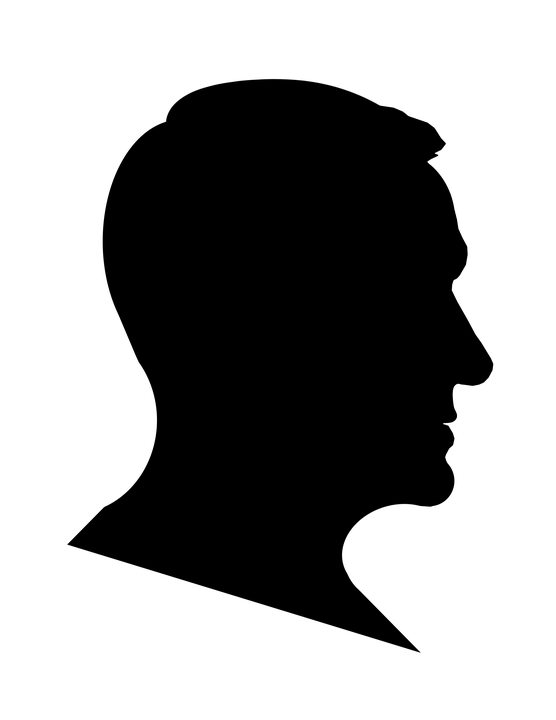Stock-Im-Eisen-Platz 2
- Bezirk
- 1., Innere Stadt
- Aliasadressen
- =Stock-Im-Eisen-Platz 2
- =Singerstraße 1
- Konskriptionsnummer
- vor 1862: 876, 877
- vor 1821: 930, 931
- vor 1795: 862, 863
- Baujahr
- 1882
- Architekten (Bau)
- Alexander von Wielemans
Zur schönen Wienerin, Zum goldenen Becher - Architektur und Geschichte
An der Ecke zur Singerstraße steht man vor dem „Haus zum goldenen Becher“, so hieß es bereits 1549 (Konskriptionsnummer 876). Das heutige Gebäude wurde 1882 von Alexander von Wielemans erbaut, der auch das Nebengebäude geplant hatte. Wielemans hatte seinen Entwurf des Platzes und der darauf stehenden Gebäude übrigens mehrfach verwertet:
Es gibt in Wien 20 noch ein identisches Haus am Wallensteinplatz 2, das nur um je eine Fensterachse länger ist, aber mit Ausnahme der Wandmalerei die gleiche Dekoration aufweist. Außerdem soll sich ein weiteres Zwillingshaus in Paris befinden.
Es lohnt sich, vor dem Haus den Kopf in den Nacken zu legen, denn hoch oben an der Fassade des Hauses befinden sich wunderschöne, zum Teil goldene, Frauendarstellungen, ein selten erhaltenes Zeugnis der späthistorischen Fassadenmalerei, die Szenen aus der Geschichte Österreichs darstellen.
Vorgängerhäuser
Die Legende zum goldenen Becher
1524 wird als Eigentümer des Hauses Stadt 876 Lassla Rätzko genannt, der Glockengießer war. Er ließ die Fürstenglocke des südlichen Heidenturmes umgießen. Der Name „Zum goldenen Becher“ leitet sich von einer Legende ab, die sich vor dem Haus zugetragen haben soll:
1549 soll während einer Fronleichnamsprozession vor diesem Haus der protestantische Bäckergehilfe Josef Hayn die Monstranz eines katholischen Priesters zu Boden geschleudert haben. Der Priester ließ daraufhin dem Burschen beide Hände abhacken, so wie die Zunge aus dem Mund reißen und ihn danach lebendig am damaligen Richtplatz, der Gänseweide (heute: Weißgerberlände), verbrennen.
Kaiser Ferdinand I. ließ an der Stelle des „Verbrechens“ vor dem Haus eine Säule mit einer Monstranz (dem goldenen Becher) anbringen. Am Nachfolgebau wurde zwischen erstem und zweiten Stock in einer Fassadennische über dem Tor der goldene Becher integriert, eine Etage höher befand sich in Verbindung mit dieser Monstranz eine zweite Skulptur, nämlich die eines Ornaments, das Jesus symbolisierte.
Zur Erinnerung steht heute in einer Nische im Hauseingang auf Seite Singerstraße 1 eine hölzerne Monstranz. Die im runden, säulenförmigen Abschluss der Bechernische angebrachte Jahreszahl 1592 weist auf das Jahr der Errichtung des ehemaligen Hauses, die darunter im Querbalken angesetzte Zahl 1661 auf das Jahr der Renovierung hin.
Die Legende hat mit Sicherheit einen wahren Kern, denn die Säule mit der Monstranz wurde wirklich aufgestellt. An ihr befand sich eine Tafel, auf der folgender Text zu lesen war:
"Anno Domini 1549, am achten des Heiligen Fronleichnams-Tag, ist durch einen gottlosen Menschen einem Priester in der Prozession das hochwürdige Sacrament unversehens aus den Händen gerissen, und an diesen Ort mit erschröcklicher Gotteslästerung auf das Erdreich geworffen wurden, um welche grausame That ihme Zungen und Hand abgehauen, folgends zu der Richtstatt geschlaifft, und dabelbst lebendig verbrennt worden. Dies ist anderen zur Warnung diese Gedächtnis hier gesetzt." [1]
Zur schönen Wienerin
Im 19. Jhdt. hieß das Haus „Zur schönen Wienerin“, benannt nach dem Damenmodengeschäft, welches der stadtbekannten Modistin Schoberlechner gehörte.
Sie stellte ab 1804 in ihren Schaufenstern eine lebensgroße Wachsfigur aus, die jeweils mit den neuesten Modekreationen aus Paris bekleidet war – damals eine Seltenheit: die Wachsfigur wurde von den Wienern heftig bestaunt. Schoberlechner war übrigens die Mutter des damals ebenso bekannten Hofopernsängers Franz Schober.
1881 stürzte das Haus teilweise ein, es wurde gemeinsam mit Haus 877 abgerissen.
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Wohn- und Sterbehaus des Lehrers Leopold Baillet
Im 18. Jahrhundert wohnte hier der französischer Sprachlehrer Leopold Baillet. Er war ab 1780 in der k.k. Realhandlungsakademie und ab 1795 Professor für die Fremdsprache Französisch am Theresianum.
Wohnhaus des Stadtschreiber Veit Griessenpeck
Zwischen 1469-1476 wohnte in dem Haus der Stadtschreiber Veit Griessenpeck (*um 1425 Landshut, † 1487 Wien, Judenplatz 2).
Haus 876
- 1373: Besitzer ist Albert Schuzzler
- 1402: Besitzer ist Simon der Zinngießer
- 1425: Eigentümer sind Stephan Scherschmid, dann Margarethe Nopper
- 1445: Margarethe vererbt das Haus ihrem Mann, dem Goldschmied Albrecht Nopper
- 1452: das Haus wird geteilt. ein Teil gehört nun dem Zinngießer Ulrich Landes und seiner Frau Dorothea, der andere der Tochter von Nopper, ebenfalls Margarethe
- 1458: Die Haushälfte von Landes wird an den Zinngießer Niclas Egker verkauft, Margarethe Nopper und ihr Mann Hanns Andre, Maler, wohnen in ihrer Hälfte
- 1468: Hanns Andre ist alleiniger Besitzer der Haushälfte.
- 1490: Der Zinngießer Peter Egker erwirbt die zweite Haushälfte
- 1523: Der Zinngießer Lassla Rätzko, der 1509 die Fürstenglocke im südlichen Heidenturm gegossen hatte, erwirbt das ganze Haus
- 1527: Der Krämer Lang und seine Frau Elisabeth kaufen das Haus, sie vererben es an ihre Kinder Katharina und Stephan
- 1548: Nach dem Tod von Stephan ist Katharina alleinige Besitzerin
- 1564: Katharina verkauft das Haus ihrem Schwager Michael Gotschalkch; der Hausbesitz wird in der Folge durch Erbregelung zersplittert
- 1621: Christoph Gotschalkch vereint den Hausbesitz durch Kauf der Teile
- 1625: Der Kürschner Georg Grätschmayer und seine Frau Barbara kaufen das Haus
- 1632: Durch einen Schenkungsvertrag gelangt das Haus in Besitz des Klosters St. Jakob an der Hülben, das Ehepaar behält sich lebenslanges Wohnrecht vor
- 1659: Nach dem Tod von Barbara verkauft das Kloster das Haus an den Leinwandhändler Johann Stadler. Dessen Erben sorgten wieder für eine Splittung des Besitzes, einer der Erben, der Hofpfennigmeister Thomas Franz Xaver Pretl, kaufte die Anteile aus.
- 1704: Das Haus gehört Thomas Franz Xaver Pretl und seiner Frau Anna
- 1723: Anna heiratet nach dem Tod Pretls und wird unter Wurzerin als Besitzerin weitergeführt
- 1755: Der Sohn Annas, Josef Pretl, verkauft das Haus an den Stadtrichter von Klosterneuburg, Christoph Josef Kueffner
- 1756: Im Rahmen eines Bieterverfahrens gelangt das Haus in Besitz von Leopold und Marie Lengfeld
- 1772: Die Kinder von Lengfeld, der Hauptmann Josef und seine Schwester Elisabeth Träge erben das Haus
- 1787: Elisabeth Träge ist nach dem Tod ihres Bruders Alleinbesitzerin
- 1791: Durch Schulden von E. Träge wird das Haus verkauft, Josef Fladung ist Höchstbietender
- 1815: Die Erben Fladungs sorgen abermals für die Zersplittung des Besitzes, bis ins Jahr 1869 sind 10 Eigentümer bekannt.
- 1881: Das baufällige Haus stürzt ein
- 1882: Alexander Wielemans erhält von Johann Czjzek Elder von Smidach den Auftrag zum Neubau
- 1928: Das Haus geht ins Eigentum der Gräfin Violetta Attems über[2]
Haus 877 Das Haus bestand aus ehemals zwei kleineren Gebäuden, Haus A und B. 877A:
- 1402: Magret Plesberger hinterlässt das Haus der Jungfrau Kathrey, mit der Auflage, dass diese eine ewige Messstiftung auf dem Maria Magdalenen Altar aufdem Karner abhalten solle.
- 1404: Der Kaplan der Messstiftung, Friedrich der Froschnh, übernimmt das Haus
- 1532: Der Benefiziant der Messer, Johann Mewsel, verkauft das Haus an den Drechlser Niclas Unnhach.
- 1552: Das Haus wird per Testament an Hanns Wutkho übertragen
- 1573: Hanns Wuthko erbt das Haus
- 1586: Hanns verkauft das Haus an den Drechlser Abraham Paltermann
- 1601: Die Witwe Sabina Paltermann verkauft es an den Glaser Georg Dietmar
- 1624: Die Tochter des Glasers, Anna, verehelichte Khessl, verkauft es an den Schuster Niklas Stockher.
- 1654: Die Witwe Stockher verkauft das Haus an den Stadtkoch Martin Scharl, er lässt das zweite kleine Haus Haus (B) mit diesem verbauen
877 B:
- 1436: Der Zinngießer Niclas Straiffing vererbt das haus an seine Söhne Hanns und Jakob
- 1451: Die Erben Jakobs verkaufen da Haus an den Wundarzt Jakob von der Ygla.
- 1469: Jakob von der Ygla vererbt das Haus dem Kloster "Zu den Predigern" in Wien. Im gleichen Jahr verkauft der Prior des Klosters das Haus an Veith Griessenpeckh
- 1476: Griessenpeckh verkauft das Haus dem Eisner Hanns Kolman
- 1480: Kauf durch Linhart Radawner
- 1482: Besitz von Stefan und Margret Puchler
- 1488: Besitz des Baders Hanns Geyssler und seiner Frau Gertraud
- 1506: Hanns Tuchler besitzt das Haus
- 1520: Margret Zisstler kauft das Haus, nach ihrem Tod fällt das Haus an die Stadt
- 1532: Der Apotheker Sydendorffer und seine Frau Margarethe kaufen das Haus
- 1546: Hanns Püchler und Barbara sind die neuen Besitzer. Sie vererbten es Anton Marinus, der es an Georg Gerngroß verkaufte.
- 1591: Der Schneider Andra Otth kauft das Haus
- 1607: Otths Witwe Katharina erhält das Haus
- 1623: Der Tischler Ciriacus Schratter erwirbt das Haus
- 1655: Der Stadtkoch Martin Scharl erwirbt das Haus und das zweite kleine Haus (A) mit diesem verbauen
- Nach 1655: Haus 877 wechselt noch zahlreiche Male die Besitzer, bis es 1881 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird
Gehe weiter zu Stock-Im-Eisen-Platz 3 | Singerstraße 2
Gehe zurück zu Stock-Im-Eisen-Platz | Singerstraße | Straßen des 1. Bezirks