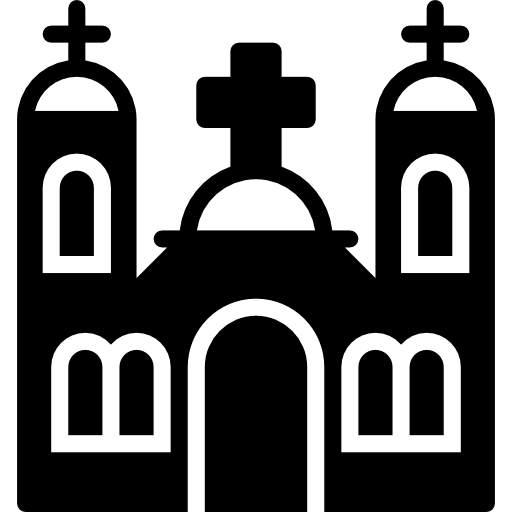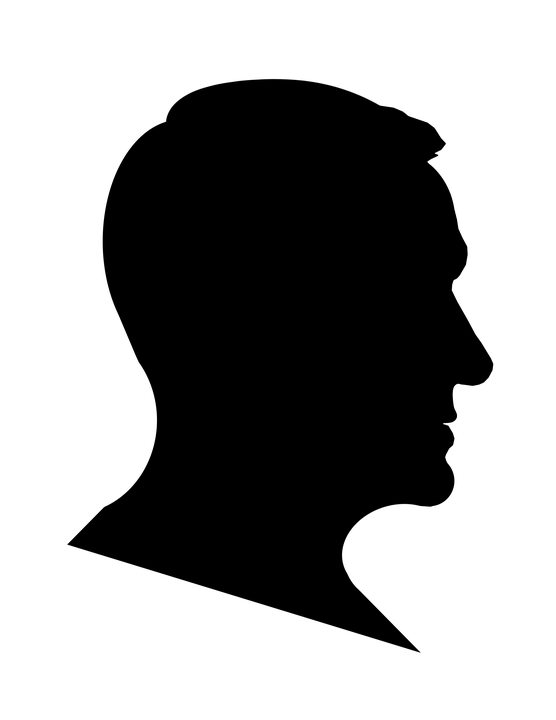Marc-Aurel-Straße 6: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Das Siebenbüchnerinnenkloster === | === Das Siebenbüchnerinnenkloster === | ||
[File:Klöster.png|90px|left]]Mit dem geplanten Klosterbau wurde schließlich 1630 begonnen, es sollte dem Kloster St. Josef gehören, jedoch auf dem Nachbargrundstück. Das neu erbaute Haus lag außerhalb des Klosterkomplexes und wurde erst später mit ihm vereinigt. Vom Schildnamen leitete sich schließlich der Spitzname des Klosters ab: "Siebenbüchnerinnenkloster". | [[File:Klöster.png|90px|left]]Mit dem geplanten Klosterbau wurde schließlich 1630 begonnen, es sollte dem Kloster St. Josef gehören, jedoch auf dem Nachbargrundstück. Das neu erbaute Haus lag außerhalb des Klosterkomplexes und wurde erst später mit ihm vereinigt. Vom Schildnamen leitete sich schließlich der Spitzname des Klosters ab: "Siebenbüchnerinnenkloster". | ||
Ein zweites Haus, das auf dem Areal stand, wurde bereits 1440 erstmals erwähnt. Besitzer war damals der spätere Bürgermeister [[Oswald Reicholf]]. 1580 war das Haus in Besitz des Hofbibliothekars Hugo Blotius, bis es 1635 vom Kloster erworben und mit dem nebenstehenden Gebäude vereint wurde. | Ein zweites Haus, das auf dem Areal stand, wurde bereits 1440 erstmals erwähnt. Besitzer war damals der spätere Bürgermeister [[Oswald Reicholf]]. 1580 war das Haus in Besitz des Hofbibliothekars Hugo Blotius, bis es 1635 vom Kloster erworben und mit dem nebenstehenden Gebäude vereint wurde. | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 09:26 Uhr
| Haus: Marc-Aurel-Straße 6 | Grund-Informationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus, der Marc-Aurel-Hof - Architektur und Geschichte
Der Marc-Aurel-Hof wurde 1890/1891 von Arnold Lotz errichtet. In Höhe des dritten Stocks ist eine Nische, in der eine Statue von Marc Aurel, dem römischen Kaiser, angebracht ist.
Vorgängerhäuser
Das Haus 456, das Haus zu den sieben Büchern
Haus 456 war das "Haus zu den sieben Büchern". Es wurde 1453 erstmals erwähnt. Kaiser Ferdinand II. erlaubte im 17. Jahrhundert erstmals wieder, das Juden nach der Vertreibung 1421 wieder Bürgerhäuser in Wien besitzen durften. So kaufte die Jüdische Gemeinde 1623 das Haus und rissen es ab, um hier eine Synagoge zu errichten. Eleonore, die zweite Ehefrau Ferdinands II. hatte jedoch andere Pläne, sie wollte hier ein Kloster errichten, und verzögerte die Baugenehmigung. Als die jüdische Gemeinde trotzdem mit dem Bau begann, konfiszierte das Herrscherhaus den Baugrund wegen "unerlaubten Bauens".
Um den Streit zu beenden, gab Ferdinand II. zur Erbauung der Synagoge ein Grundstück am Unteren Werd frei (auf dem heute die Leopoldskirche steht).
Das Siebenbüchnerinnenkloster
Mit dem geplanten Klosterbau wurde schließlich 1630 begonnen, es sollte dem Kloster St. Josef gehören, jedoch auf dem Nachbargrundstück. Das neu erbaute Haus lag außerhalb des Klosterkomplexes und wurde erst später mit ihm vereinigt. Vom Schildnamen leitete sich schließlich der Spitzname des Klosters ab: "Siebenbüchnerinnenkloster".
Ein zweites Haus, das auf dem Areal stand, wurde bereits 1440 erstmals erwähnt. Besitzer war damals der spätere Bürgermeister Oswald Reicholf. 1580 war das Haus in Besitz des Hofbibliothekars Hugo Blotius, bis es 1635 vom Kloster erworben und mit dem nebenstehenden Gebäude vereint wurde.
Nachdem das Kloster aufgehoben worden war, gelangte es zur Versteigerung, 1888 schließlich kaufte es die Stadt Wien und ließ es demolieren.
Haus 457
1438 scheint das Haus mit Pferdestall in Urkunden erstmals auf. 1864 wurde es von der Stadt Wien erworben, um es 1888 mit dem Nebenhaus abreißen zu lassen.
Ab 1707 war das Haus in Besitz des Bürgermeisters Johann Lorenz Trunck von Guttenberg (* 30. Juli 1661 Wien, † 7. September 1742, Wien). In Truncks Amtszeit fiel die letzte große Pest-Epidemie (1719), Der Bürgermeister vererbte das Haus an seinen Sohn.
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Hausbesitzer Bürgermeister Christoph Fasoldt
| Persönlichkeit | Christoph Fasoldt |
|---|---|
|
Hausbesitzer im 16. Jahrhundert war Bürgermeister Christoph Fasoldt (* 20. August 1583, Hollfeld, † 29. März 1641, ebenhier). Fasoldt war ab 1616 im Äußeren Rat, später auch im Inneren Rat. Seine Amtszeit als Bürgermeister dauerte ein Jahr (1638-1639). Als er starb, entbrannte um sein Erbe ein heftiger Streit - er hatte kein Testament, aber mehrere Häuser und 16 Weingärten hinterlassen. |
Gehe weiter zu Sterngasse 5-7 | Marc-Aurel-Straße 7
Gehe zurück zu Sterngasse | Marc-Aurel-Straße | Straßen des 1. Bezirks