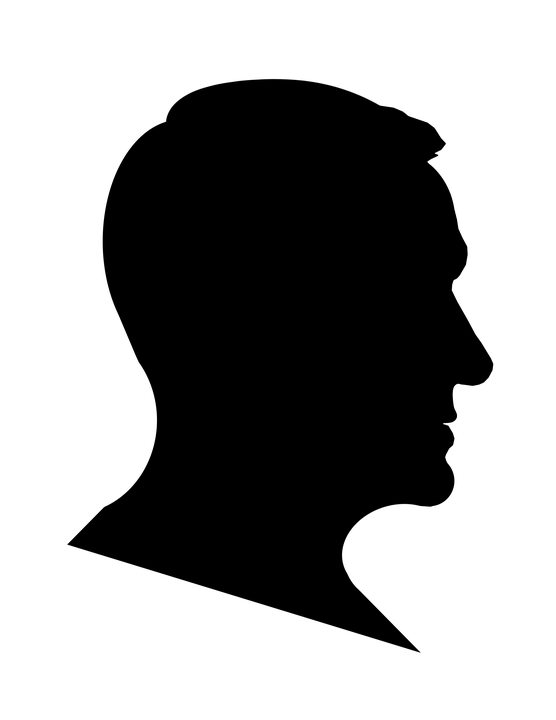Sterngasse 3: Unterschied zwischen den Versionen
(→Das Haus Wiener Neustädter Hof; auch: "Zu den sieben gelben Sternen" - Architektur und Geschichte) |
|||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor="#B40404" | |||
!<span style="color:#ffffff"> Haus: '''{{PAGENAME}}'''</span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Grund-Informationen'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[datei:Wiener Neustädter Hof 2.jpg|200px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | |style="background-color:#f1f1f1; " | Aliasadressen | ||
|style="background-color:#f1f1f1; width=15%" | =[[Sterngasse]] 3 | |style="background-color:#f1f1f1; width=15%" |=[[Sterngasse]] 3 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | |style="background-color:#ffffff;" | Ehem. Konskriptionsnummer | ||
|style="background-color:#ffffff;" | 507 | |style="background-color:#ffffff;" | Stadt, vor 1862: 507 | vor 1821: 541 | vor 1795: 477 | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | |style="background-color:#f1f1f1;" | Baujahr | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Architekt | |style="background-color:#ffffff;" | Architekt | ||
|style="background-color:#ffffff;" | Anton Ospel, Johann Pauli | |style="background-color:#ffffff;" | Anton Ospel, Johann Pauli<br /> | ||
|} | |||
|} | |} | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
== Das Haus Wiener Neustädter Hof; auch: "Zu den sieben gelben Sternen" - Architektur und Geschichte == | == Das Haus Wiener Neustädter Hof; auch: "Zu den sieben gelben Sternen" - Architektur und Geschichte == | ||
Das Haus mit der frühbarocken Fassade wurde 1735 erbaut. Früher wurde es als Durchhaus zum Hohen Markt und in die Krebsgasse (heute Teil der Marc-Aurel-Straße) genutzt, mittlerweile sind die Tore verschlossen. Den Namen hat | Das Haus mit der frühbarocken Fassade wurde 1735 erbaut. Früher wurde es als Durchhaus zum Hohen Markt und in die Krebsgasse (heute Teil der Marc-Aurel-Straße) genutzt, mittlerweile sind die Tore verschlossen. Den Namen hat das Haus durch seine Besitzer erhalten: die Zisterzienserabtei von Wiener Neustadt. Die Abtei betrieb hier auch eine Ausschank, den Neustädter Keller. | ||
Nachdem sich das Kloster hoch verschuldet hatte, legte man es mit dem Stift Heiligenkreuz zusammen. | Nachdem sich das Kloster hoch verschuldet hatte, legte man es mit dem Stift Heiligenkreuz zusammen. | ||
== Der angekettete Stein == | == Der angekettete Stein == | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
An der Fassade hängt ein 79 Pfund schwerer Stein. Es handelt sich hier um eine Türkenkugel, die am 20. Juli 1683 aus der Leopoldstadt gegen die Stadt abgefeuert worden war. | An der Fassade hängt ein 79 Pfund schwerer Stein. Es handelt sich hier um eine Türkenkugel, die am 20. Juli 1683 aus der Leopoldstadt gegen die Stadt abgefeuert worden war. | ||
{| class=" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |- | ||
| [[File:Vienna - Sterngasse Nr.3 Gedenktafe anno 1683.jpg| | | [[File:Vienna - Sterngasse Nr.3 Gedenktafe anno 1683.jpg|250px]] | ||
Anno 1683 Jahr<br /> | | Größte Türkenkugel im 1. Bezirk | ||
| Anno 1683 Jahr<br /> | |||
den 20 Julü ist dis<br /> | den 20 Julü ist dis<br /> | ||
er Stein aus einer<br /> | er Stein aus einer<br /> | ||
| Zeile 42: | Zeile 49: | ||
tt, hereingeworff<br /> | tt, hereingeworff<br /> | ||
en worden. Wegt<br /> | en worden. Wegt<br /> | ||
79 Pfundt.<br /> | 79 Pfundt.<br /><br /> | ||
|} | |} | ||
== Vorgängerhaus == | == Vorgängerhaus == | ||
| Zeile 55: | Zeile 60: | ||
=== Wohn- und Sterbehaus von Ladislav Pyrker === | === Wohn- und Sterbehaus von Ladislav Pyrker === | ||
In dem Haus wohnte und starb der Dichter und Erlauer Erzbischof Ladislav Pyrker von Felsö-Eör (* 2. November 1772 Nagy-Lángh, Ungarn, † 2. Dezember 1847, ebenhier). Pyrker war nach seinem Studium in das Zisterzienserkloster eingetreten. Seine Gedichte wurden von Schubert vertont, er gilt auch als Förderer des jungen Grillparzer. | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Ladislav Pyrker'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
In dem Haus wohnte und starb der Dichter und Erlauer Erzbischof [[Ladislav Pyrker]] von Felsö-Eör (* 2. November 1772 Nagy-Lángh, Ungarn, † 2. Dezember 1847, ebenhier). Pyrker war nach seinem Studium in das Zisterzienserkloster eingetreten. Seine Gedichte wurden von Schubert vertont, er gilt auch als Förderer des jungen Grillparzer. | |||
Nach Pyrker ist die [[Pyrkergasse]] im 19. Bezirk benannt. | |||
2023 wurde hier eine Gedenktafel angebracht: | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Anlass/Persönlichkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:Gedenktafel_Johann_Ladislaus_Pyrker.jpg|250px]] | |||
| [[Johann Ladislaus Pyrker]] | |||
| In diesem Haus starb<br /> | |||
am 2. Dezember 1847<br /> | |||
der Dichter und Mäzen<br /> | |||
<br /> | |||
Johann Ladislaus Pyrker.<br /> | |||
<br /> | |||
Er war Abt des<br /> | |||
Zisterzienserstiftes Lilienfeld 1812-1819.<br /> | |||
Bischof von Zips 1818-1820.<br /> | |||
Patriarch von Venedig 1821-1827.<br /> | |||
Patriarch-Erzbischof von Erlau 1827-1847.<br /> | |||
ein Förderer von<br /> | |||
Franz Schubert, Franz Grillparzer<br /> | |||
und Josef Danhauser,<br /> | |||
ein Gründungsvater des<br /> | |||
Kurortes Bad Hofgastein<br /> | |||
und ein Gründungsmitglied der<br /> | |||
Österr. Akademie der Wissenschaften.<br /> | |||
<br /> | |||
Gewidmet am 2. Dezember 2022<br /> | |||
anlässlich seines 175. Todestages<br /> | |||
im Jahre seines 250. Geburtstages<br /> | |||
<br /> | |||
|} | |||
|} | |||
=== Wohn- und Sterbehaus des Juristen Matthias Wilhelm Virgilius Haan === | === Wohn- und Sterbehaus des Juristen Matthias Wilhelm Virgilius Haan === | ||
Der Sohn des Justizhofrats Johann Georg Haan, Matthias Wilhelm Virgilius Haan ( * 27. November 1737 Wien, † 10. Dezember 1816, ebenhier) wohnte ebenfalls in diesem Haus. Haan war Beamter der Niederösterreichischen Landesregierung und machte dort - bis zum Amt des Präsidenten des Niederösterreichischen Landrechts, eine steile Karriere. Während der französischen Besatzung 1805 sorgte er für die Eintreibung der Zwangssteuer, und war Gegner der Folterstrafe in Form von Prügeln, für deren Abschaffung er eintrat. | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Matthias Wilhelm Virgilius Haan'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
Der Sohn des Justizhofrats Johann Georg Haan, [[Matthias Wilhelm Virgilius Haan]] ( * 27. November 1737 Wien, † 10. Dezember 1816, ebenhier) wohnte ebenfalls in diesem Haus. Haan war Beamter der Niederösterreichischen Landesregierung und machte dort - bis zum Amt des Präsidenten des Niederösterreichischen Landrechts, eine steile Karriere. Während der französischen Besatzung 1805 sorgte er für die Eintreibung der Zwangssteuer, und war Gegner der Folterstrafe in Form von Prügeln, für deren Abschaffung er eintrat. | |||
|} | |||
=== Wohn- und Sterbehaus des Dichters Johann Baptist Alxinger === | === Wohn- und Sterbehaus des Dichters Johann Baptist Alxinger === | ||
Alxinger, dessen Pseudonym Xilanger war (* 24. Jänner 1755 Wien, † 1. Mai 1797, ebenhier), war eigentlich gelernter Jurist. Sein Interesse am Theater führte dazu, dass er in die Theaterverwaltung wechselte und ab 1794 Hoftheatersekretär war. Alxinger verbreitete die Ideen der Aufklärung und nutzte dazu die "Österreich Monatsschrift", die er gemeinsam mit Schreyvogel herausgab. Ab 1781 gehörte er der Freimaurer-Loge "Zur wahren Eintracht" an, er arbeitete hier an dem "Journal für Freymaurer" mit. Nach ihm sind die Alxingergasse (10. Bezirk) und der Alxingerstein (im Pötzleinsdorfer Schlosspark, 18. Bezirk) benannt. | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Johann Baptist Alxinger'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
[[Johann Baptist Alxinger]], dessen Pseudonym Xilanger war (* 24. Jänner 1755 Wien, † 1. Mai 1797, ebenhier), war eigentlich gelernter Jurist. Sein Interesse am Theater führte dazu, dass er in die Theaterverwaltung wechselte und ab 1794 Hoftheatersekretär war. Alxinger verbreitete die Ideen der Aufklärung und nutzte dazu die "Österreich Monatsschrift", die er gemeinsam mit Schreyvogel herausgab. Ab 1781 gehörte er der Freimaurer-Loge "Zur wahren Eintracht" an, er arbeitete hier an dem "Journal für Freymaurer" mit. | |||
Nach ihm sind die [[Alxingergasse]] (10. Bezirk) und der [[Alxingerstein]] (im Pötzleinsdorfer Schlosspark, 18. Bezirk) benannt. | |||
|} | |||
=== Wohn- und Sterbehaus des Religionsphilosophen Anton Günther === | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- bgcolor=" #37526f" | |||
!<span style="color:#ffffff"> '''Persönlichkeit''' </span> | |||
!<span style="color:#ffffff"> ''' Anton Günther'''</span> | |||
|- | |||
| style="background-color:#dedede" | [[File:KopfX.png|150px|center]] | |||
| style="background-color:#dedede" | | |||
[[Anton Günther]] (* 17. 11.1783, Lindenau, † 24. 2.1863, ebenhier) hatte Philosophie, Jus und Theologie studiert und wurde 1821 zum Priester geweiht. Ab 1824 war er als Privatgelehrter in Wien tätig, er hatte den Orden verlassen, weil er ihm zu autoritär erschien. Er entwickelte neue Ideen zu einer katholisch philosophischen Lehrer und entwickelte damit den "Güntherianismus". Seine Ansätze veröffentlichte er 1857, sofort setzte die Kirche das Werk auf den Index verbotener Bücher. Seine Schüler begründeten - durch ihn inspiriert - den Altkatholizismus. . | |||
Nach ihm ist die [[Günthergasse]] im 8. Bezirk benannt. | |||
|} | |||
== | == Wien - Eine Stadt stellt sich vor == | ||
Der Wiener Neustädter Hof trägt das Schild Nummer 119 der Aktion "[[:Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor|Wien - Eine Stadt stellt sich vor]]". | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! Bild | |||
! Sehenswürdigkeit | |||
! Text der Tafel | |||
|- | |||
| [[File:Sterngasse 3 IMG 6609.JPG|center|250px]] | |||
| 1, Sterngasse 3 | |||
| Wiener <br /> | |||
Neustädter Hof<br /> | |||
1734<br /> | |||
vielleicht nach Entwurf von<br /> | |||
Anton Ospel erbaut.<br /> | |||
|} | |||
| Zeile 84: | Zeile 175: | ||
[[Kategorie:Architekten:Johann Pauli]] | [[Kategorie:Architekten:Johann Pauli]] | ||
[[Kategorie:Architekten:Anton Ospel]] | [[Kategorie:Architekten:Anton Ospel]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:1. Bezirk - Häuser]] | ||
[[Kategorie:Wohn- und Sterbehäuser]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Gedenktafeln]] | ||
[[Kategorie:1. Bezirk - Wohn- und Sterbehäuser]] | |||
[[Kategorie:Freimaurer]] | [[Kategorie:Freimaurer]] | ||
[[Kategorie:Eine Stadt stellt sich vor]] | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2024, 09:16 Uhr
| Haus: Sterngasse 3 | Grund-Informationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Das Haus Wiener Neustädter Hof; auch: "Zu den sieben gelben Sternen" - Architektur und Geschichte
Das Haus mit der frühbarocken Fassade wurde 1735 erbaut. Früher wurde es als Durchhaus zum Hohen Markt und in die Krebsgasse (heute Teil der Marc-Aurel-Straße) genutzt, mittlerweile sind die Tore verschlossen. Den Namen hat das Haus durch seine Besitzer erhalten: die Zisterzienserabtei von Wiener Neustadt. Die Abtei betrieb hier auch eine Ausschank, den Neustädter Keller.
Nachdem sich das Kloster hoch verschuldet hatte, legte man es mit dem Stift Heiligenkreuz zusammen.
Der angekettete Stein
An der Fassade hängt ein 79 Pfund schwerer Stein. Es handelt sich hier um eine Türkenkugel, die am 20. Juli 1683 aus der Leopoldstadt gegen die Stadt abgefeuert worden war.
Vorgängerhaus
1467 findet sich das Haus bereits in Dokumenten, ab Mitte des 16. Jahrhunderts wird als Besitzer Wolfgang Voglsinger angegeben. 1708 kauften es die Zisterzienser und ließen es schließlich für den Neubau abreißen.
Wohnhaus bekannter Persönlichkeiten
Wohn- und Sterbehaus von Ladislav Pyrker
| Persönlichkeit | Ladislav Pyrker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
In dem Haus wohnte und starb der Dichter und Erlauer Erzbischof Ladislav Pyrker von Felsö-Eör (* 2. November 1772 Nagy-Lángh, Ungarn, † 2. Dezember 1847, ebenhier). Pyrker war nach seinem Studium in das Zisterzienserkloster eingetreten. Seine Gedichte wurden von Schubert vertont, er gilt auch als Förderer des jungen Grillparzer. Nach Pyrker ist die Pyrkergasse im 19. Bezirk benannt. 2023 wurde hier eine Gedenktafel angebracht:
|
Wohn- und Sterbehaus des Juristen Matthias Wilhelm Virgilius Haan
| Persönlichkeit | Matthias Wilhelm Virgilius Haan |
|---|---|
|
Der Sohn des Justizhofrats Johann Georg Haan, Matthias Wilhelm Virgilius Haan ( * 27. November 1737 Wien, † 10. Dezember 1816, ebenhier) wohnte ebenfalls in diesem Haus. Haan war Beamter der Niederösterreichischen Landesregierung und machte dort - bis zum Amt des Präsidenten des Niederösterreichischen Landrechts, eine steile Karriere. Während der französischen Besatzung 1805 sorgte er für die Eintreibung der Zwangssteuer, und war Gegner der Folterstrafe in Form von Prügeln, für deren Abschaffung er eintrat. |
Wohn- und Sterbehaus des Dichters Johann Baptist Alxinger
| Persönlichkeit | Johann Baptist Alxinger |
|---|---|
|
Johann Baptist Alxinger, dessen Pseudonym Xilanger war (* 24. Jänner 1755 Wien, † 1. Mai 1797, ebenhier), war eigentlich gelernter Jurist. Sein Interesse am Theater führte dazu, dass er in die Theaterverwaltung wechselte und ab 1794 Hoftheatersekretär war. Alxinger verbreitete die Ideen der Aufklärung und nutzte dazu die "Österreich Monatsschrift", die er gemeinsam mit Schreyvogel herausgab. Ab 1781 gehörte er der Freimaurer-Loge "Zur wahren Eintracht" an, er arbeitete hier an dem "Journal für Freymaurer" mit. Nach ihm sind die Alxingergasse (10. Bezirk) und der Alxingerstein (im Pötzleinsdorfer Schlosspark, 18. Bezirk) benannt. |
Wohn- und Sterbehaus des Religionsphilosophen Anton Günther
| Persönlichkeit | Anton Günther |
|---|---|
|
Anton Günther (* 17. 11.1783, Lindenau, † 24. 2.1863, ebenhier) hatte Philosophie, Jus und Theologie studiert und wurde 1821 zum Priester geweiht. Ab 1824 war er als Privatgelehrter in Wien tätig, er hatte den Orden verlassen, weil er ihm zu autoritär erschien. Er entwickelte neue Ideen zu einer katholisch philosophischen Lehrer und entwickelte damit den "Güntherianismus". Seine Ansätze veröffentlichte er 1857, sofort setzte die Kirche das Werk auf den Index verbotener Bücher. Seine Schüler begründeten - durch ihn inspiriert - den Altkatholizismus. . Nach ihm ist die Günthergasse im 8. Bezirk benannt. |
Wien - Eine Stadt stellt sich vor
Der Wiener Neustädter Hof trägt das Schild Nummer 119 der Aktion "Wien - Eine Stadt stellt sich vor".
| Bild | Sehenswürdigkeit | Text der Tafel |
|---|---|---|
| 1, Sterngasse 3 | Wiener Neustädter Hof |
Gehe weiter zu Sterngasse 4
Gehe zurück zu Sterngasse | Straßen des 1. Bezirks