1. Karolinen-Kinderspital

- Bezirk
- 9., Alsergrund
- Aliasadressen
- =Sobieskigasse 31/31A
- =Ayrenhoffgasse 5
- Konskriptionsnummer Thury, Lichtenthal
- vor 1862: - Grünfläche Ruprechtsgasse
- vor 1847: -
- vor 1821: -
- vor 1795: -
- Baujahr
- 1878, Zubauten: 1896
- Architekten (Bau)
- Ferdinand Dehm, Franz Olbricht, Eugen Fassbender
Das Haus, erstes Karolinen-Kinderspital - Architektur und Geschichte
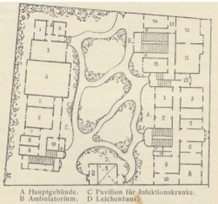
Errichtet wurde das erste Karolinen-Kinderspital als Kinderspital von Ferdinand Dehm, die Stiftung für ein Kinderspital mit 24 Betten geht auf Karoline Riedl († 1878) zurück. Sie wollte damit mittellosen Kindern der Pfarre Lichtental helfen.[2] Die Anstalt wurde knapp nach ihrem Tod, am 4. November 1879, in einem umgebauten Wohnhaus in der damaligen Schubertgasse 2 (heute Schubertgasse 23) eröffnet.[3] Eine Erweiterung auf 50 Betten war durch einen Zubau im Jahr 1896 möglich. 1912 bis 1913 entstand schließlich der groß dimensionierte Neubau an der Sobieskigasse 31 nach Plänen von Eugen Fassbender, der 1914 eröffnet wurde und rund 120 Betten umfasste.[4][5] 1906 wurde auch eine Neugeborenenstation eingerichtet.
Der Bau des Kinder-Infektionspavillons an der Ayrenhoffgasse wurde 1923 bis 1925 nach Plänen des Stadtbauamt-Architekten Adolf Stöckl vorgenommen.[6] In der NS-Zeit wurde das Spital umbenannt und unter dem Namen „Emil von Behring-Kinderkrankenhaus“ geführt.[7]
1951 wurde die hier integrierte Pathologie in die Allgemeine Poliklinik verlegt, 1977 schloss man das Spital; die Abteilungen wurden in das damalige Wilhelminenspital (heute Klinik Ottakring) verlegt.[8]
Die Stiftung
Die Stiftung wird heute durch die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes und die MA40 betreut.
Der heutige Zweck, der dem Grunde nach dem damaligen folgt, lautet so: [9]
- Förderung der Gesundheitspflege in Hinblick auf Kinder und Jugendliche und diesen nahestehende Personen mit dem Zweck der Gesundheitsförderung sowie medizinischen, therapeutischen und psychosozialen Versorgung, um stationäre Aufenthalte in Gesundheitseinrichtungen zu vermeiden, soweit diese nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von den Sozialhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- oder Sozialversicherungsträgern zu erbringen oder zu finanzieren sind
- Fürsorge für kranke Kinder und Jugendliche sowie diesen nahestehende Personen in Hinblick auf eine Lebensbewältigung und ein lebenswertes Leben außerhalb stationärer Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen, soweit diese nicht aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von den Sozialhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- oder Sozialversicherungsträgern zu erbringen oder zu finanzieren sind
Heutige Nutzung
Nach der Schließung des Spitals im Jahr 1977 und der Verlegung der Abteilungen in das damalige Wilhelminenspital wurde der Baukomplex in den 1980er-Jahren schrittweise umgenutzt. Zwischen 1983 und 1987 wurde das Gebäude zu einem Heim für behinderte Jugendliche mit Tagesheimstätte umgebaut; die Planung stammt von den ArchitektInnen Edith Lassmann und Lucio Philipp Lichtenecker.[10]
Heute sind hier unter anderem Einrichtungen von „Jugend am Werk“, ein Kindergarten und eine Kompetenzstelle zur Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen untergebracht.[11]
Gedenktafel
Ambulatorium
und
Infektionsabteilung
des
Karolinen-Kinderspitales
der Stadt Wien
Erbaut
in den Jahren 1923-1925
unter den Bürgermeistern
Jakob Reumann und Karl Seitz
und den Amtsführenden Stadträten
Hugo Breitner
Franz Siegel
Prof. Dr. Julius Tandler
von dem Direktor
Prof. Dr. Wilhelm Knöpfelmacher
nach den Plänen und ausgeführt vom
Wiener Stadtbauamt
durch
Ing. Architekt Adolf Stöckl
und
Ing. Hans Gundacker
Ansichten
- Ansichten
Kapelle im Kinderspital um 1936 [12]
Kinderübnernahmestelle um 1926[13]
Infektionskrankensaal um 1926[14]
→ weiter zu Sobieskigasse 32 | Ayrenhoffgasse 6
← zurück zu Sobieskigasse | Ayrenhoffgasse
Quellen
- ↑ NN: Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts : ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung, Band 2: Hochbau und Architektur, Plastik und Kunstsammlungen, Gerlach & Wiedling, Wien, 1906. S. 250
- ↑ http://www.architektenlexikon.at/de/83.htm
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Karolinen-Kinderspital
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karolinen-Kinderspital
- ↑ https://www.routeyou.com/de-at/location/view/48092841
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Infektionspavillon_des_Karolinen-Kinderspitals
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Karolinen-Kinderspital
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Krankenh%C3%A4user_im_Nachkriegs-Wien
- ↑ https://www.wien.gv.at/recht/gemeinderecht-wien/fonds-stiftungen/stiftungen/riedl.html
- ↑ https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karolinen-Kinderspital
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_-_ehem._Karolinen-Kinderspital,_Gedenktafel.JPG
- ↑ Martin Gerlach jun. (Fotograf), Kapelle im Karolinen Kinderspital (9., Sobieskigasse 31), Blick gegen den Altar, um 1936, Wien Museum Inv.-Nr. 211004, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/26316/)
- ↑ Unbekannt, 9., Sobieskigasse 31 / Ayrenhoffgasse 9 - Kinderübernahmestelle, um 1926, Wien Museum Inv.-Nr. 57962/79, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/421990/)
- ↑ Carl (Karl) Zapletal (Fotograf), 9., Sobieskigasse 31 / Lustkandlgasse 50 / Ayrenhoffgasse 9 - Kinderübernahmestelle - Infektionskrankensaal - Innenansicht, um 1926, Wien Museum Inv.-Nr. 57962/94, CC0 (https://sammlung.wienmuseum.at/objekt/422014/)
![Kapelle im Kinderspital um 1936 [12]](/images/6/68/Karolinen_Kinderspital_Kapelle_Wien_Museum_Online.jpg)
![Kinderübnernahmestelle um 1926[13]](/images/e/e7/Karolinen_Kinderspital_Wien_Museum_Online_1.jpg)
![Infektionskrankensaal um 1926[14]](/images/0/04/Karolinen_Kinderspital_Wien_Museum_Online_2.jpg)